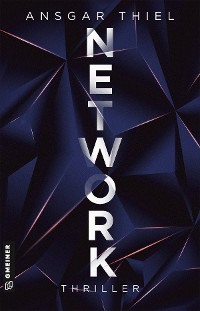Kitabı oxu: «Network»
Ansgar Thiel
Network
Thriller

Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!



Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
info@gmeiner-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © peshkov / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6964-0
Zitat
»The future will be utopian or there will be none.«
Slavoj Žižek: The Reality of the Virtual (2004)
Mallmann
29.11.2046
Doktor Arthur Mallmann, Erfinder der Virtual Work und designierter Fraktionsgeschäftsführer der Erneuerungspartei für Demokratie (EPD) im deutschen Staatsparlament, hatte noch genau neun Minuten zu leben, als er es sich nach einem arbeitsreichen Tag in seinem Loungechair bequem machte. Er blickte durch die Glasfront seines Arbeitszimmers im 62. Stock des Ludwig-Erhard-Buildings auf seine Stadt. Doch heute hatte er keinen Sinn für das Lichtermeer, das sich unter dem Berliner Nachthimmel vor ihm ausbreitete. Es kotzte ihn an. Die Idee der Netzarbeit, wie er sie noch vor vier Jahren stolz präsentiert hatte, war nicht so umgesetzt worden, wie er es sich erhofft hatte. Von der idealen Welt, die er in seinen Reden versprochen hatte, war nicht viel zu sehen. Es war an der Zeit, Veränderungen herbeizuführen. Die würden sich noch wundern. Auch wenn sie ihn nun aufs Abstellgleis geschoben hatten. Aber er durfte nicht unvorsichtig werden. Seine Gegner würden vor nichts zurückschrecken, wenn sie erfuhren, was er vorhatte.
Er erhob sich und schritt vor der Glasfront auf und ab. Er musste noch die Antrittsrede für morgen durchgehen, bevor Pescz, sein Assistent, zur Besprechung kam. Über »die Zukunft der Arbeit« würde er reden, über »sein« Thema, als ehemaliger Arbeitsminister der europäischen Regierung. Eigentlich hatte er keine Lust mehr zum Üben, aber er musste sich morgen topfit präsentieren, die Erwartungen waren hochgesteckt.
Ein Exemplar der einzigen Berliner Zeitung, die noch auf gedruckte Ausgaben setzte, lag auf dem kleinen Eileen-Gray-Beistelltischchen. Die Schlagzeile: Der Vater der Virtual Work wird morgen zum Paten, sprang ihn an.
Er nahm die Zeitung auf und las noch einmal den Artikel. Die Journalisten hatten sich an die Abmachungen gehalten. Sie brachten genau die Phrasen, die auch er gerne verwendete.
»Was wäre Europa heute ohne Doktor Arthur Mallmann? Das Volk hätte kein Utopia der Arbeit, es hätte nicht einmal Arbeit! Und heute gibt es Virtual Work für jeden.«
Das war gut. »Utopia der Arbeit«. Zumindest theoretisch stimmte es ja auch, dachte er sich, deshalb könnte er diese Aussage auch in seiner Rede bringen, direkt vor den EPD-Werbeslogans zur Virtual Work, die er in jeder Rede brachte: »Verwirklichen Sie sich selbst«, »Holen Sie alles aus Ihren Begabungen heraus«, »Sie sind der König, Sie sind der Chef« und »Ohne Netz kein Frieden«.
Er ging zum Spiegel und betrachtete sich eingehend. Er war zufrieden mit sich. Groß, für einen 60-Jährigen recht sportlich und dennoch distinguiert. Nur seine Frisur war ein ständiger Stachel für sein Selbstbewusstsein.
Mit einem Kamm zog er einen sorgfältigen Scheitel und arrangierte die dünnen Strähnen wie einen Läufer über die Lichtung.
»Wünschen Sie noch etwas, mein Herr?«
Mallmann wirbelte herum. Er würde sich nie an seinen Servanten gewöhnen, dessen katzenhafte Bewegungen kaum hörbar waren.
»Würden Sie mir bitte etwas zu trinken bringen?«
Die nackte Kopfhaut des Servanten glitzerte, als er sich in Bewegung setzte, um Mallmann ein Glas frisch gepressten Orangensaft zu holen. Mallmann sah ihm nach und rief sich noch einmal die Einleitungssätze seiner Rede ins Gedächtnis. »Den Menschen ging es noch nie so gut wie heute. Das Netz bietet allen die Arbeit, die sie wollen, der Staat gibt allen Geld zum Leben. Wenn es je ein Paradies auf Erden gegeben hat, dann heute.«
Er musste nur aufpassen, dass er dies auch glaubwürdig vermittelte. Angewidert schüttelte er den Kopf. Er war froh, dass sich der Servant nicht zu oft in seiner Nähe aufhielt. Irgendwie traute er ihm nicht. Servanten waren zwar praktisch. Und weitaus günstiger als menschliche Angestellte. Doch auch wenn er in seinen öffentlichen Reden immer das Gegenteil behauptete, konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, sie könnten als künstliche Intelligenzen dem Menschen seinen Platz auf Erden streitig machen.
Er zwang sich zu einem Lächeln, als der Servant ihm das Glas reichte. Am liebsten wäre er einen Schritt vor dieser großen, grazilen Gestalt mit den gefühlskalten Kryolitglasaugen zurückgetreten. Die Garantie der Humanoid-Industrie auf unbedingten Gehorsam beruhigte ihn nicht. Einmal hatte er mit eigenen Augen gesehen, wie gewalttätig Servanten sein konnten. Ein Bettler hatte ihn angegriffen, und sein Security-Servant war eingeschritten.
Er schüttelte den Kopf, verdrängte die unangenehmen Bilder und wandte seine Gedanken wieder seiner Rede zu. Vielleicht sollte er noch etwas intellektueller wirken.
Er ging zurück zum Tischchen und nahm die Zeitung wieder in die Hand.
»Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor der Einführung der Virtual Work? 45 Prozent Arbeitslose in den Vereinigten Staaten von Europa. Ohne die IT-unterstützte Revolution der Humandienstleistungen hätte sich Europa nie aus der Rezession retten können.«
»Die Revolution der Humandienstleistungen, die größte Errungenschaft des 21. Jahrhunderts!« Exzellent. Im Grunde konnte er morgen auch einfach den Zeitungsartikel vortragen. Er setzte sich wieder in seinen Sessel und kratzte sich am Kinn.
Wenn er ehrlich war, konnte er es kaum fassen, dass das gemeine Volk sich immer noch mit dieser Phrase abspeisen ließ. Mallmann wusste genau, dass die hohe Arbeitslosigkeit auch in den rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz begründet lag. Unternehmen konnten nun neben Lohnnebenkosten auch gleich die Lohnkosten sparen. Medizinische Technik ersetzte einen Teil des medizinischen Personals. Verwaltungsangestellte waren weitgehend überflüssig. Und am Bankschalter stand man ohnehin schon lange vor Displays.
Erneut schüttelte er den Kopf und nahm einen Schluck Orangensaft.
»Herr Doktor Mallmann, guten Abend.«
Mallmann ließ vor Schreck sein Glas fallen.
Sein Assistent zuckte schuldbewusst zusammen und las die Glasscherben auf.
»Sind Sie verrückt geworden, mich so zu erschrecken?«, zeterte Mallmann. »Und wie kommen Sie überhaupt hier rein?«
»Die Tür stand offen, ich bin einfach eingetreten.«
Wie jedes Mal erregten die blecherne Stimme und das Leichengräbergesicht des Assistenten eine kaum zu unterdrückende Abscheu bei Mallmann, sodass er ganz vergaß, sich über die offene Tür zu wundern.
»Was gibt’s?«
»Herr Doktor, wir wollten die Rede durchgehen. Sie dürfen den Dank für die Unterstützung der Wirtschaft nicht vergessen.«
Mallmann spürte, wie er innerlich verkrampfte. Sein Ärger verdrängte auch noch den letzten Rest des unheimlichen Gefühls, das ihn seit mehreren Tagen fast durchgehend begleitet hatte. Dank an die Wirtschaft! Wer hatte denn die Schriften für die Top-Managementseminare vor zehn Jahren verfasst? Er! Und von wem kamen die programmatischen Aussagen, wie »Eine unproblematische Steigerung des Wirtschaftswachstums ist nur bei gleichzeitiger finanzieller Stabilisierung der Politik möglich« und »Die Politik braucht Geld, um ihrem Auftrag der Sicherung kollektiver Güter in angemessenem Maße nachkommen zu können«? Von ihm!
Das waren noch echte Pionierzeiten gewesen, dachte sich Mallmann. Finanzielle Stabilisierung der Politik, keine Steuern zahlen! Aktiv Geld einsetzen und mitbestimmen können, wohin es fließt, wenn schon die Politiker nichts mehr auf die Reihe bekamen, außer sich gegenseitig zu diskreditieren. Für damalige Zeiten ein ungewöhnlicher Gedanke. Aber logisch. Keine Arbeit, kein Geld – kein Geld, Unruhen, gesellschaftliche Instabilität. Was brauchte es also, wenn schon keine Arbeit da war? Nahrung und Unterhaltung, Brot und Spiele statt Hunger und Unruhe – ein voller Magen besänftigt so manchen aggressiven Gedanken.
Er musste diesen Schnösel von Assistenten in seine Schranken weisen. »Mein Lieber, die Philosophie unserer Partei ist eine ökonomische«, dozierte er. »Die Wirtschaft kann nur wachsen, wenn es keine Störung der Ordnung gibt.«
Er ging zum Fenster und blickte auf den Alexanderplatz. »Arbeitslose stören die Ordnung. Und davon hatten wir noch vor vier Jahren mehr als genug. Deshalb Beschäftigung, deshalb Cyber Game, deshalb Virtual Work. Wer muss hier also wem danken?«
Mallmann streckte die Brust heraus. Er war stolz auf das Programm der EPD und vor allem auf seine eigenen Verdienste. Er ging zum Holovisionsgerät und schaltete es ein. Die vier Jahre alte Dokumentation seines heute schon legendären Interviews mit Faye Brown im Morgenmagazin auf CNN Europe erschien.
»Meine Damen und Herren, ab heute 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit sind in 14 Bundesstaaten Europas bis auf wenige Ausnahmen alle Arbeitslosen zur Virtual Work verpflichtet. Die restlichen Bundesstaaten werden in wenigen Wochen mit der Umsetzung des Arbeitsprogramms der Zentralregierung folgen.
Bis gestern hatten wir in Europa noch eine Arbeitslosenquote von 45 Prozent. Ab heute ist Arbeitslosigkeit Geschichte. Europa macht etwas wahr, wovon es schon lange träumt: den sozialen Unruhen und sozialer Ungleichheit ein Ende zu setzen. Das behauptet zumindest unsere Regierung.
Wir werden uns in der folgenden halben Stunde intensiv mit Virtual Work auseinandersetzen. Als Gast im Studio begrüßen wir Herrn Doktor Arthur Mallmann, den Arbeitsminister der europäischen Zentralregierung. Guten Morgen, Herr Doktor Mallmann, wird Virtual Work das halten, was Sie uns versprechen?«
»Guten Morgen, Frau Brown. Eigentlich mag ich den Begriff Netzarbeit lieber als Virtual Work. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das keine schweißtreibende, spaßfreie und gezwungene Arbeit, wie wir sie von früher kennen. Wir bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl beruflicher Wahlmöglichkeiten. Dabei soll die individuelle Neigung entscheidend für die Wahl sein. Wer Arzt werden will, kann Arzt werden, wer lieber zupacken will, kann zupacken. Sie können dort arbeiten, wo sie wollen: in Oberbayern, an einem oberitalienischen See, unter dem blauen Himmel der Sierra Nevada, in Metropolen im Stile von Paris, London und Berlin und so weiter und so weiter. Die Menschen erhalten eine zweiwöchige transkranielle neurokognitive Schnellausbildung. Jeden Tag nur sechs Stunden. Dann sind sie bereits Experten im Job ihrer Wahl. Zumindest in der virtuellen Welt.«
»Herr Doktor Mallmann, Sie gelten als der Vater dieser ganzen Sache. Erzählen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wie Sie auf die Idee kamen.«
»Das liegt doch auf der Hand. Ich nehme an, Sie sind mit den Kriminalitätsstatistiken der letzten Jahre vertraut. Ich sage nur: Menschen, die nichts zu tun haben, gründen Gangs, veranstalten Chaos und Randale und Vandalismus. Mit Bürgergeld und geregelter Netzarbeit geben wir sozusagen Brot und Spiele. Und dass das funktioniert, wissen wir seit den alten Römern.«
»Die USA haben ja ähnliche Pläne. Aber dort gibt es große Widerstände, dass alle arbeitslosen Bürger künftig zur Netzarbeit verpflichtet werden, also arbeiten müssen.«
»Warum reden Sie von ›müssen‹? Arbeiten ist doch jetzt kein Muss mehr im negativen Sinne. Arbeit soll Spaß machen. Und außerdem: Wollen Sie es lieber so haben wie bisher? Bettler, Straßenschlachten und Unruhen?«
»Dennoch unterliegen die Reichen keiner Arbeitspflicht.«
»Wir sind eine Partei für alle Bürgerinnen und Bürger. Warum erwähnen Sie nicht, dass auch Schwerkranke und Menschen mit geistiger Behinderung befreit werden?«
»Die werden, wenn sie aus weniger betuchten Familien stammen, in den schlecht betreuten und verrotteten staatlichen Heimen ihrem Siechtum überlassen, oder?«
»Frau Brown, jetzt kommen wir vom Thema ab.«
»Dann lassen Sie uns über das sogenannte Säkularisierungsgesetz sprechen.«
»Nicht schon wieder!«
»Sie sind doch derjenige, der immer behauptet, die virtuelle Realität sei die einzige Chance, gleichzeitig den Artikel neun der Europäische Menschenrechtskonvention und die öffentliche Ordnung zu wahren.«
»Ich kann nur ein weiteres Mal betonen, dass die Verbannung jeglicher sichtbaren religiösen Symbolik aus dem öffentlichen Raum die einzige Möglichkeit war, um zu verhindern, dass sich die Leute auf offener Straße den Schädel einschlagen.«
»Ja, aber Artikel neun sagt auch, dass man seine Religion ungestört ausüben können und den Gesetzmäßigkeiten entsprechend zu handeln erlaubt sein muss. Und betroffen ist vor allem nur ein Teil der Bevölkerung.«
»Ich weiß sehr gut, worauf Sie anspielen. Dazu kann ich Ihnen nur sagen: Kreuze dürfen Sie auch nicht offen am Körper tragen. Außerdem haben wir nur Burka, Nikab und Hidschab verboten. In den Gotteshäusern ist nach wie vor jegliche religiöse Symbolik erlaubt. Und jetzt mal ehrlich. Keine Frau wird sanktioniert, wenn sie ein Kopftuch aufhat …«
»Solange es schön bunt und modisch aussieht …«
»Deshalb sage ich ja, dass unsere neue Netzwelt die Lösung für all diese Probleme ist. Zur Virtual Work, oder wo auch immer sonst, dürfen sie so verschleiert, wie sie wollen, gehen. Freie Religionsausübung ist jetzt wieder erlaubt. Halt eben im Netz und nicht außerhalb.«
»Bislang …«
»Frau Brown – unser System ist besser und gerechter als jedes andere, und dieses Projekt wird unsere Welt noch besser machen.«
»Tja, wir sind alle gespannt, Herr Mallmann. Schauen wir mal, wie unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ihren ersten Netzarbeitstag beginnen …«
Ein schepperndes Geräusch im Eingangsbereich ließ ihn aufschrecken.
Die Wohnungstür fiel leise ins Schloss.
Fragend schaute Mallmann seinen Assistenten an. Der zuckte mit den Schultern, schaltete das Holovisionsgerät aus und ergriff das elektronische Paper mit dem Gesetzestext zur Regelung der Virtual Work, das auf der Küchenplatte direkt neben dem Entsafter lag.
»Wir müssen üben«, sagte er streng und begann vorzulesen.
§ 1
»Jede*r Bürger*in der Vereinigten Staaten von Europa (EUS) über 18 und unter 75 Jahren ist zur virtuellen Arbeit verpflichtet, mit Ausnahme folgender Gruppen:
(1) Personen, die einen Beruf außerhalb des Netzes ausüben, dessen Ausübung mindestens 20 Stunden pro Woche umfasst, bei maximal 30 Urlaubstagen pro Jahr.
(2) Personen, die sich in einem Ausbildungsverhältnis für eine Berufstätigkeit außerhalb des Netzes befinden.
(3) Studierende an den europäischen Staats- und Elitehochschulen bis zu einer maximalen Studiendauer von neun Semestern (Undergraduate) beziehungsweise 13 Semestern (Graduate).
(4) Promovierende an den europäischen Staats- und Elitehochschulen bis zu einer maximalen Promotionsdauer von vier Jahren.
(5) Erziehungsberechtigte von Kindern unter eineinhalb Jahren.
(6) Medizinische Sonderfälle, soweit sie unter Paragraf 11, Absatz (1) – (121) aufgelistet werden.
(7) Personen ohne Arbeit außerhalb des Netzes, die eine einmalige Zahlung von 250.000 Euro an die staatliche Netzverwaltung leisten und ein liquides Privatvermögen von mindestens einer Million Euro nachweisen können. Der Nachweis muss jährlich erfolgen.
(8) Ausnahmen für § 1, (1) – (4) werden durch das SVGBV geregelt.
»Ha, das war ein Kampf mit der Opposition, die Netzarbeitspflichtbefreiung von arbeitslosen Personen mit großem Privatvermögen!« Mallmann hatte ein verklärtes Lächeln auf dem Gesicht.
Pescz ignorierte den Einwurf und fuhr fort.
§ 2
Netzarbeitspflichtige sind verpflichtet, an fünf Tagen die Woche virtuell zu arbeiten. Im Allgemeinen sind während dieser fünf Tage jeweils acht Stunden täglich abzuleisten, ausgenommen folgende Gruppen:
(1) Mütter oder Väter, die als Erziehungsberechtigte gelten und deren Kinder noch unter dem Pflichtalter für den Besuch eines Ganztagskindergartens oder einer Ganztagsschule sind. Für diese gilt eine tägliche Netzarbeitspflicht von fünf Stunden.
Mallmann hatte genug.
»Hören Sie auf!«, schimpfte er und hielt sich die Ohren zu. »Ich soll Gesetze pauken, ich, der federführend an deren Erarbeitung beteiligt war? Verschwinden Sie!«
Er packte seinen Assistenten an den Schultern und schob ihn Richtung Wohnungstür.
»Aber, Herr Doktor …«, stammelte dieser.
»Es reicht!«
Pescz verbeugte sich hastig und flüchtete Richtung Ausgang.
Mallmann atmete tief durch. Der Zornausbruch tat ihm fast schon wieder leid. Sein Assistent hatte ja recht. Er musste sich vorbereiten. Nicht, dass morgen Fragen kamen, auf die er als ehemaliger Arbeitsminister keine Antworten wusste.
Ein lautes Krachen ließ ihn zusammenfahren. War Pescz noch nicht weg?
Er ging zur Garderobe.
Vielleicht war es der Servant. Möglicherweise ein elektronisches Problem. So etwas gab es ja anscheinend. Er musste sich in Acht nehmen.
Vorsichtig bewegte er sich in Richtung Eingang. Kurz vor dem Garderobenbereich blieb er stehen. Servanten sind ja nicht aggressiv gegen ihre Besitzer, versuchte er, sich zu beruhigen, meistens jedenfalls.
Mit einem flauen Gefühl im Magen bewegte er sich ein paar Schritte weiter und sah sich nach einem Gegenstand um, mit dem er sich gegen einen Angriff zur Wehr setzen konnte. Da war nichts Geeignetes. Er horchte, ob sich der Servant wohl in einem der vorderen Zimmer befand.
»Hallo?«
Kein Laut war zu hören.
Mallmann wandte sich der Tür zu und sah rechts neben dem Eingang mehrere zerbrochene Vasen liegen.
Meine Güte, die teuren Dinger, die kosten ein Vermögen, schoss es ihm trotz der wachsenden Angst durch den Kopf.
Die Tür stand offen. Kein Servant weit und breit.
Mallmann bewegte sich zögernd drei Schritte weiter. Sein Herz raste. Er öffnete die Wohnungstür und lauschte. Kein Geräusch.
Vorsichtig betrat er den Flur. Niemand zu sehen.
»Wo ist er denn? Ich glaube, ich alarmiere den Pförtner-Servanten«, murmelte er vor sich hin, während er sich rückwärtsgehend wieder in die Wohnung zurückzog.
Er öffnete die Tür zur begehbaren Garderobe. Sein Herz setzte einen Schlag aus, als er den Servanten dort am Boden liegen sah, von den in Reih und Glied aufgehängten Ausgehmänteln halb verdeckt.
Er war gerade im Begriff nachzuschauen, was dem Servanten passiert war, als er sich auch schon für seine Unaufmerksamkeit verfluchte.
Genau in dem Moment, in dem er sich umdrehte, sauste der Baseballschläger, den er als 14-Jähriger von seinem Onkel zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte und der normalerweise direkt neben den Fotos von seinen Eltern an der Garderobenwand hing, auf ihn nieder. Die Drehung rettete ihm, wenn auch nur kurzfristig, das Leben, denn der Schläger traf ihn nur an der Schulter.
Mallmann krachte zu Boden.
Als er mit schmerzverzerrter Miene versuchte, sich in eine halb liegende Position zu erheben, erblickte er seinen Angreifer. Seine Augen weiteten sich ungläubig, als er erkannte, wer vor ihm stand. Ihm blieb nur noch Zeit für ein »Warum?«, bevor der Schläger seine Schädeldecke zerschmetterte und seinem so aktiven und erfolgreichen Leben ein Ende setzte.
Fuller
David Fuller erzählte seinen Wellensittichen von Propriozeptiver Neuromuskulärer Fazilitation. Es störte ihn nicht, dass sich die Vögel der Sepiaschale in der Mitte des Käfigs widmeten und seinem Vortrag über diese physiotherapeutische Behandlungsmethode keinerlei Beachtung zu schenken schienen. Er referierte über Exterozeptoren, Telerezeptoren und Propriozeptoren als gäbe es nichts Interessanteres auf dieser Welt.
Das Schrillen des schwarzen Weckers riss ihn aus seinen Ausführungen. Fuller schüttelte Arme und Beine aus und begann sein tägliches Karate-Training. Mentales Fokussieren nannte er diese Übung. Nach zehn Minuten hörte er auf und trocknete seinen nackten Oberkörper ab, ordnete seine schüttere Frisur und schlenderte ins Wohnzimmer.
Dort legte er sich auf eine alte Massagebank, befestigte vorschriftsmäßig die Elektroden für die Virtual-Stimulation an Stirn, linker Schläfe und Brustbein und loggte sich ein.
Fünf Minuten später räkelte sich eine nackte Frau auf der komfortablen Lederliege seiner virtuellen Praxis. Seine Hände wanderten von ihren Fußsohlen hinauf zu den Unterschenkeln. Langsam und gefühlvoll massierte er die wohlgeformten Waden. Die Frau hob ihren Kopf, schüttelte ihr langes schwarzes Haar und schenkte ihm ein aufreizendes Lächeln, was seinen Unterleib zum Kribbeln brachte. Derart animiert ließ er seine Hände mit sanftem Druck über die Oberschenkel gleiten, umkurvte ihre Pobacken, um schließlich mit kreisenden Bewegungen im Lendenbereich zu verweilen.
Seine Patientin schien die Behandlung zu genießen. Fuller lächelte. Er war ein Virtuose, es gab keinen besseren: Der menschliche Körper war seine Klaviatur. Seine Kundinnen und Kunden schworen auf die sinnliche Magie seiner Fingerspiele. Er war sich sicher, dass er diesen Beruf sogar in der analogen Welt hätte ausüben können, wenn man dort noch Physiotherapeuten gebraucht hätte und nicht das meiste von Servanten erledigt worden wäre.
Sein Blick fiel durch die Fensterfront seines Studios auf die überwältigende Kulisse der sonnenbestrahlten Berner Alpen – eine Aussicht, an der er sich nicht sattsehen konnte. Jetzt wanderten seine Hände an der Außenseite ihres Rückens empor bis zu den seitlichen Ansätzen ihrer Brüste, die nicht besonders groß, aber perfekt geformt waren. Kundig stimulierte er mit den Fingerspitzen die besonders sensiblen Punkte unterhalb der Achseln.
Auch wenn ihn der morgendliche Übergang ins Arbeitsleben stresste, liebte er seinen Job. Er stieß einen zufriedenen Seufzer aus, was die Frau dazu veranlasste, sich nach ihm umzudrehen. Beruhigend lächelte er ihr zu. So gut hatte er sich früher nie gefühlt. Er liebte seinen Avatar, er war groß, muskulös, hatte lange, schwarz gelockte Haare, ein markantes Kinn und strahlend weiße Zähne. Die künstlich stimulierten Endorphine, die durch seine Adern flossen, verschafften ihm ein Wohlgefühl.
Gerade als er sich an die Nackenmuskulatur der Frau machen wollte, richtete diese sich auf. Ihre blauen Augen musterten ihn eindringlich. Er spürte, wie seine Schultermuskulatur verkrampfte. Es fühlte sich alles vollkommen real an, auch das Hämmern seines Herzens. Wo hatte die Frau plötzlich die Pistole her? Und warum zielte sie auf ihn? Und wie konnte es sein, dass sich die Kugel so langsam auf ihn zubewegte und er dennoch nicht in der Lage war, ihr auszuweichen?
Für einen kurzen Moment zuckte die Erinnerung an eine CNN-Meldung über einen Serienmörder im Netz durch sein Bewusstsein, bevor es um ihn herum schlagartig dunkel wurde.