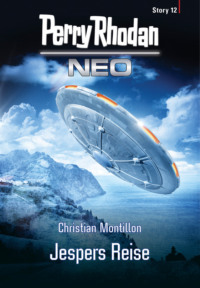Kitabı oxu: «Perry Rhodan Neo Story 12: Jespers Reise»

NEO-Story 12
Jespers Reise
Eine PERRY RHODAN NEO-Erzählung
von Christian Montillon
Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Rückentext
Jesper ist sechzehn Jahre alt und wächst auf einer Azoreninsel auf. Die Umgebung ist wunderschön, mitten in der Natur fühlt sich der Jugendliche wohl. Doch er leidet darunter, dass seine Eltern sich von der Außenwelt abkapseln.
Sein Vater ist nämlich ein Weltraumleugner. Er glaubt nicht, dass es fremde Planeten gibt, auf denen Außerirdische leben. Und er kann sich nicht vorstellen, dass Menschen wie Perry Rhodan bereits mit Raumschiffen durch das All reisen. Entsprechende Berichte hält er für erlogen und gefälscht.
Jesper kann sich mit dieser Sicht auf die Welt nicht abfinden. Er will die Zukunft erleben, möchte nach Terrania reisen. Seine Fahrt zur Hauptstadt der Erde wird für den Jugendlichen zu einem unglaublichen Abenteuer …
Kapitel 1
Vor der Krise
Die Sonne schien, es stank nach Schwefel, und ich aß einen Maiskolben – natürlich frisch in der Erde gekocht. Das war der besondere Stolz der Einheimischen.
Und zugegeben, es schmeckte prima.
Das Leben auf der Insel bot durchaus angenehme Seiten. Der Schwefelgestank zählte nicht dazu, doch auch daran gewöhnte man sich mit der Zeit.
Ich beobachtete gern die Touristen, die in den Sommermonaten an den heißen Quellen vorbeispazierten und das Gesicht wegen des Gestanks der Dampfwolken verzogen. Sie kamen üblicherweise auf die Azoreninseln, um Ruhe zu finden. Aber ausgerechnet an diesem Ort hielten sie es nicht lange aus – obwohl es nirgends sonst mehr Friede gab. Ich kannte nichts Beruhigenderes als das Blubbern der Quellen und die eigentümliche Hitze in der Luft.
»Schau dir das an!«, rief eine Frau – ziemlich laut, um trotz des Tosens gehört zu werden, das so nahe bei der größten Quelle alles übertönte. »Wie auf einem anderen Planeten!«
Da war es wieder, das Drama meines Lebens.
Was der Begleiter der Touristin antwortete, hörte ich nicht mehr, und der Appetit auf den Maiskolben, den die geothermische Hitze im Erdboden durchgegart hatte, verging mir gründlich.
Wie auf einem anderen Planeten.
Für die meisten Leute war diese Vorstellung völlig normal. Für mich nicht. Genauer gesagt: für meine Familie nicht. Und noch genauer gesagt: für meinen Vater nicht.
Denn für ihn gab es keine anderen Planeten. Also, die Planeten schon – so verschroben war nicht mal mein Dad. Aber er akzeptierte nicht, dass es dort fremde Intelligenzen gab, und erst recht nicht, dass wir seit fast einem Jahr in Kontakt mit Außerirdischen standen.
Er glaubte es einfach nicht.
Nach allem, was passiert war, glaubte er es nicht!
Und damit machte er mein Leben zur Hölle.
Schon der sechzehnjährige Sohn eines Weltraumleugners zu sein, war ziemlich übel. Deshalb mochte ich mir nicht vorstellen, wie es sein musste, mit einem Weltraumleugner sogar verheiratet zu sein. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter ansah, erkannte ich aber, dass sie nicht zufrieden war.
Dad war als Spinner verschrien, auf der ganzen Insel kannten die Einheimischen seine Einstellung inzwischen. Sie hielten ihn für verrückt, womöglich stimmte das auch. Vielleicht galt das für mich genauso. Er war mein Vater, oder?
Wie konnte man leugnen, dass es außerirdisches Leben gibt? Fast ein Jahr, nachdem Perry Rhodan auf dem Mond die Arkoniden getroffen hat … nachdem die Fantan die Erde besucht hatten? Man musste sich nur Bilder dieser Leute anschauen und irgendwelche wahllosen Berichte im Netz ansehen, um zu wissen, dass das die seltsamsten Aliens aller Zeiten waren!
Aber mit Beweisen durfte man meinem Dad nicht kommen. Gefälscht, sagte er. Weil die uns angeblich für dumm verkauften. Wer die waren, erklärte er nie; wahrscheinlich wusste er es selbst nicht. Mal meinte er die Regierung, mal den einen oder anderen ominösen Geheimbund, mal diejenigen, die sich hinter der Maske der NASA versteckten. Ich hatte nie gefragt, was er damit sagen wollte; die Antwort konnte ich mir ausmalen. Verrücktes Zeug, eben.
Ich warf den Rest des Maiskolbens in die Quelle. Das mit hohem Druck aus der Erde sprudelnde Wasser schleuderte ihn zurück. Er landete ein paar Meter entfernt auf dem rot gemusterten Felsboden und kullerte davon. Ein Zaun verhinderte, dass man dorthin kam – dabei wäre ohnehin niemand dumm genug, freiwillig in das Gebiet zwischen den kochenden Quellen zu klettern. Schon der intensive Gestank schreckte ab, von den Verbrühungen, die man bei einem Spaziergang dort davontrüge, ganz zu schweigen.
»… gesehen?«, hörte ich. »Einfach den Maiskolben weggeworfen.«
»Wir mischen uns da nicht ein«, sagte eine zweite Stimme, die eines Manns diesmal.
Ich drehte mich um. Ein Pärchen stand dort, Hand in Hand. Sie mochten siebzehn, achtzehn Jahre alt sein. Kaum älter als ich. Sie war hübsch, mit ihrem langen, braunen Haar. Und beide waren normal, bestimmt keine Kinder von Weltraumleugnern. Stattdessen fuhren ihre Eltern mit ihnen in Urlaub – ein, zwei Wochen auf den Azoren, wie klingt das?
Und mein Dad? Der floh vor der Welt, vor den Medien, vor der Wahrheit. Wir ziehen dorthin, wo andere Urlaub machen, hatte er gesagt. Das klang sogar gut, solange man seine Motive nicht durchschaute. Auf der kleinen Insel São Miguel kannte ihn niemand, dort lebte es sich einsam, dort konnte er seinem verschrobenen Weltbild frönen. Oder uns schützen, wie er es nannte.
Das war ungerecht.
Und es machte mich wütend.
Mein Gesicht wurde kalt. Meine Nase. Ich sah meinen Atem als Wölkchen vor dem Hintergrund des Schwefeldampfs über der Quelle.
»Nein«, flüsterte ich. »Nicht!«
Das Mädchen schaute mich an. Es grinste.
Sie denkt, dass ich ein Spinner bin, der mit sich selbst redet. Was ich ja auch tat. Aber nur, weil ich mich fürchtete – vor mir, vor dem, was in mir lauerte. Dummerweise machte mich dieser Gedanke noch wütender.
Und deshalb wurde es noch kälter.
Ich stand auf, ließ die Quellen hinter mir, ging auf den großen See im Furnas-Vulkankrater zu, dessen üppig bewachsene Steilwände halb im Sonnenschein, halb im diesigen Nebel hingen. Ich mochte den Anblick: ein Schutzwall um mich und mein Leben. Leider sah ich zu lange nach oben, denn ich verfing mich in einer der Baumwurzeln, die sich über den Weg zogen, bis zum Ufer des grünlich schimmernden Sees.
Ich versuchte, mich abzufangen, fiel aber hin.
»Das hat er davon«, hörte ich, gefolgt von einem kurzen Kichern.
Unnötig zu sagen, dass mich das noch wütender machte. Als ich mich hochstemmte, gefror die Pfütze, in die meine Fingerspitzen reichten.
Einer der seltenen Fahrradfahrer rollte an mir vorbei. Täuschte ich mich, oder schaute er mich irritiert an?
Die Pfütze war keine Pfütze, wie ich im nächsten Augenblick bemerkte, sondern ein Ausläufer des Sees in der flachen Uferwiese. Die Vereisung schlängelte sich langsam zwischen dem Gras hindurch. Einzelne Halme überzogen sich mit einer Schicht aus Reif.
Die Touristin starrte mit geweiteten Augen auf das Ufer. Sie schrie auf.
Nur das nicht. Keine Aufmerksamkeit wecken. Ich stand auf, entfernte mich. Das Eis würde in der Hitze des Tages schnell tauen, und nichts blieb zurück.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte ich. Aber warum kochte dann die Wut in mir, stärker als die heißen Quellen? Wieso ging ich auf das Pärchen zu?
Die beiden machten einen Schritt rückwärts, bis sie mit dem Rücken an den Zaun vor den Dampfschwaden stießen. Sie fürchteten sich vor mir. Wer mochte ihnen das verdenken? Schließlich war ich ein noch größerer Freak als mein Vater.
»Du bist ein Mutant!« Die Angst des Manns wich einem anderen Ausdruck. Er taxierte mich wie ein seltenes Tier in einem Käfig. »Ich hab davon gehört. Aber es selbst zu sehen, ist irre. Was genau kannst du?«
»Ich bin kein Ausstellungsstück«, sagte ich. Oder dachte ich es nur? Jedenfalls stand ich plötzlich auch am Zaun und verlor jede Kontrolle. Über meinen Zorn und erst recht über … das in mir.
Mit einem Mal war alles still, bis auf den Ruf der zahlreichen Vögel, oben, am Kraterwall. Es gab nur noch den Gesang, und ich begriff, warum er mir so seltsam vorkam. Eigentlich dürfte ich ihn nicht hören – das Rauschen und Kochen der Quellen, das Wallen der Dampfschwaden müsste ihn übertönen.
Normalerweise.
Doch die Quellen kochten nicht mehr.
Die Dampfschwaden erstarrten in der Luft.
Es knackte, als sich Eiskristalle bildeten und wie Hagelkörnchen herabprasselten. Es klirrte wie tausend Scherben auf der gefrorenen Wasseroberfläche.
Ein Schrei. Von der jungen Frau? Dem Mann? Von mir?
Ich hob meine Hände. Die Finger zitterten.
»Kann ich dir helfen?«, hörte ich, aber ich sah alles nur noch verschwommen. Mein Herz schlug viel zu schnell.
Wieder ertönte ein Knacken, lauter diesmal, und ich sah, wie ein Riss in der Eisschicht aufplatzte und sich verbreiterte, weiterjagte, sich verästelte.
Die gefrorene heiße Quelle explodierte.
Eisbrocken krachten gegen den Zaun. Etwas hämmerte an mein Knie. Tränen schossen mir in die Augen. Sie erstarrten bereits am unteren Augenlid in der Kälte.
Dann klatschte es heiß auf meine Beine, und ich sog zischend die Luft ein. Das nachströmende Wasser hatte die Eisschicht über der Quelle gesprengt und quoll nun mit aufgestautem Druck aus der Erde. Kochende Fluten schmolzen knackend das Eis rundum.
Eine Hand umfasste meinen Arm. Ich sah auf.
»Kann ich dir helfen?«, wiederholte der junge Mann. Konnte er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Plötzlich stöhnte er. »Was … Was ist das?« Seine Kleidung gefror. Eine Reifschicht legte sich auf sein Gesicht.
Seine Freundin stand unvermittelt vor mir, zwischen uns. Sie rammte mir beide Fäuste gegen die Brust, stieß mich weg. Ich taumelte rückwärts. Der Griff um meinen Arm löste sich. Der Zaun knirschte hinter mir.
»Geh weg! Weg!«, schrie sie.
Ich wusste nicht, was ich tat, aber die Frau gab einen gurgelnden Laut von sich, riss den Mund auf und schnappte nach Luft.
»Ich … nicht … i-ich …« Ich stotterte wie ein Idiot und konnte den Blick nicht von ihr wenden. Von ihren Augen. Sie erstarrten unter einer Eisschicht, und das linke Auge stand noch offen. Ich sah das helle Braun ihrer Iris, leicht verzerrt wie hinter einer Glasscheibe, und das geweitete Schwarz ihrer Pupille.
Ich rannte weg, vor zum Touristenparkplatz, wo mein Fahrrad angekettet wartete.
»Emy!«, hörte ich den entsetzten Ruf, irgendwo in einer anderen Welt.
Das ist nicht passiert. Das eben ist einfach nicht passiert!
Vielleicht konnte ich das von meinem Vater lernen: Leugnen war keine üble Sache, auch wenn die Tatsachen dagegensprachen.
Pulsuz fraqment bitdi.