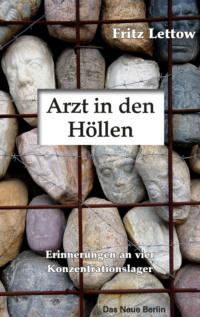Kitabı oxu: «Arzt in den Höllen»
Erinnerungen an vier Konzentrationslager
Mit einem Nachwort von Gerhard Leo.
Das Neue Berlin
Impressum
eISBN 978-3-360-50067-0
© 2013 Verlag Das Neue Berlin, Berlin
© der Originalausgabe (2., ergänzte Auflage)
by edition ost, Berlin 1997
Covergestaltung: Verlag
unter Verwendung eines Motivst von bigstock.com
Bilder: privat
Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlin erscheinen
in der Eulenspiegel Verlagsgruppe
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Meinen Kameraden gewidmet, von denen viele ein gleiches oder ähnliches Schicksal durchstanden
Vorwort
Obwohl es vielleicht nicht uninteressant wäre, auf diesen Seiten ausschließlich einen persönlichen Lebensbericht zu geben, so scheint das dennoch unnötig: Nicht von einem, angesichts der zu schildernden Ereignisse viel zu kleinen Einzelschicksal soll die Rede sein. Das Los Hunderter, Tausender und vieler Zehntausender von Menschen aller Nationen hingegen, das der Verfasser teilte, ist es wohl wert, geschildert zu werden.
Viele Bücher sind über das Thema der Nazi-Konzentrationslager schon geschrieben worden, und manches wird noch entstehen. Das Besondere, das der Verfasser mit seiner Schilderung der Vorgänge im Auge hat, besteht in folgendem: Zunächst ist es der unbedingte Wille, möglichst objektiv zu sein und nichts nach der einen oder der anderen Seite hin zu verfärben. Und da der Leser all dem Ungeheuerlichen, das in diesem Buche beschrieben wird, notwendigerweise misstrauisch gegenübersteht, nennt der Verfasser am Schluss seines Berichtes eine Reihe von Zeugen, die zusammen mit ihm für die Objektivität der Darstellung bürgen. Zum anderen will der Verfasser versuchen, auch eine kleine Psychologie von typischen Reaktionen der in den Lagern Inhaftierten zu schreiben und die allgemeinen menschlichen Reaktionen darzustellen, denen jeder dort zu seinem eigenen Erstaunen mehr oder weniger unterworfen war.
Der Verfasser hatte ungefähr vier Jahre lang das zweifelhafte Glück im Unglück, in den Revieren, den Krankenhäusern von vier verschiedenen Nazi-Konzentrationslagern tätig gewesen zu sein. Er konnte dort eine Reihe von Vorgängen miterleben, die nur wenige Menschen je gesehen haben. Schon allein dieser Beobachtungen wegen ist es notwendig, die vorliegenden Aufzeichnungen zu veröffentlichen.
Dieses Buch ist – ohne dass es von vornherein die besondere Absicht des Verfassers war – eine Anklage: Es musste zu einer Anklage gegen die furchtbare und brutale Willkür im »Dritten Reich« werden. Mögen jene, die dafür Verantwortung tragen, ihre gerechte und harte Strafe finden.
Dieses Buch ist aber auch eine Rechtfertigung für die zum Teil ungeheuerlich anmutenden Dinge, die unter dem Zwang einer brutalen Diktatur von den Eingekerkerten selbst getan werden mussten. Alle bisherigen, alle üblichen bürgerlichen oder christlichen oder sonstigen Maßstäbe versagten. Nur die Notlage drückte dem Verhalten gebieterisch ihren Stempel auf, nötigte zum Handeln. So zwang man diese der Freiheit Beraubten in eine Welt, die scheinbar jenseits von Gut und Böse lag. Instinktiv empfand wohl ein jeder, dass sich alle Prinzipien ins Gegenteil verkehrt hatten. Diese Tatsache zu bedenken, sie auszusprechen oder zu Papier zu bringen, wird nur wenigen gegeben sein. Um so mehr ist es Pflicht, hier das Notwendige zu berichten.
Auf diesen Seiten ist viel sprachlich Anstößiges unkorrigiert erhalten geblieben. Der Verfasser ist sich dessen wohl bewusst, und er hätte alles Vulgäre, das fein empfindende Menschen vielleicht abstoßen mag, wegschleifen können. Aber warum sollte er die grobe Sprache der Konzentrationslager, die er selbst so viele Jahre lang gesprochen hatte, verfälschen?
Fritz Lettow,
Herbst 1945
Bildung, Ausbildung, Politik
Wir schrieben das Jahr 1929. Da brach es über uns herein, über uns in Deutschland, in Europa, in der Welt. Der große Bankenkrach, den der »Schwarze Freitag« an der New Yorker Börse auslöste und die Weltwirtschaftskrise mit ihrer großen Arbeitslosigkeit packten uns. Viele, viele Banken machten damals bankrott, und in ihrem Strudel versanken Tausende von Existenzen, von Menschen.
Zweimal hatte uns das Schicksal schon ereilt, einmal im Ersten Weltkrieg und dann wieder in der Inflationszeit; zweimal verloren wir das meiste, manche fast alles, was sie besaßen und was ihnen lieb war. Und nun kam der dritte Schicksalsschlag.
Oh, wir gut behüteten Bürger, wie war mit uns Schindluder getrieben worden! Und wir wussten nicht, woher das kam, wir nahmen das als Schicksal!
Mein Vater, Lehrer an einer höheren Schule, hatte sich 1914 freiwillig ins Feld gemeldet, ein halbes Jahr später traf ihn der tödliche Schuss. Wir, die Familie, blieben verarmt zurück. Die kleine Rente der Mutter reichte nicht hin und nicht her. Und ein paar Jahre später, in der Inflationszeit am Anfang der zwanziger Jahre, gingen unsere letzten Ersparnisse endgültig dahin.
Zu Ende war die Zeit des zufriedenen, soliden Bürgerlebens, vorbei war es mit der hellen Vaterlandsbegeisterung. Unseres besten Schutzes waren wir nun beraubt, mühselig und zu äußerster Sparsamkeit gezwungen, schlugen wir uns durch.
Mit Stipendien in der Schule konnten wir uns das Schulgeld ersparen. Hie und da konnte man von einem Verwandten einen Anzug erwischen, der gewendet und weiter benutzt wurde, und Stundengeben für schwächere Schüler aus besser gestellten Familien ermöglichte es schon während der Schulzeit, ein paar zusätzliche Markstücke zu verdienen. Das war nicht uninteressant und gab Auftrieb.
Nicht allen war es jedoch so schlecht ergangen, manche hatten sich durch diese schweren Jahre gut, sehr gut hindurchgefunden. Unter meinen Mitschülern befanden sich viele Söhne von Adligen und Großgrundbesitzern, meist aus der märkischen Gegend, sogar ein Prinz von Waldeck war dabei. Sie waren in einem feudalen Pensionat am Rande der Stadt untergebracht und gingen gut gekleidet, diese schlanken, stolzen Gestalten, die sich als die Elite der Nation wähnten. Allerdings waren sie durchweg weder klug noch charaktervoll. Mit reichlich Taschengeld in den Händen, mit reichlich Dünkel ausgestattet und in ihrer Faulheit nicht zu übertreffen, bildeten sie eine feste Clique, in die kein »Bürgerlicher« hineinkam. Sie versuchten, in den Klassen den Ton anzugeben. In ihren »Literarischen Verein« nahmen sie nur Mitschüler auf, die ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprachen. Wir aus der farblosen Mittelschicht standen abseits, beiseite, einen irgendwie versteckten Ingrimm im Herzen, einen Zweifel an der Richtigkeit dieser Welt. Damals schon bildete sich in mir eine kritische Einstellung zu dieser feudalen Oberschicht heraus.
Trotzdem übertrugen sich die politischen Einstellungen, die an der Schule herrschten, in gewisser Weise auch auf mich. Das im Grunde streng konservative, ausgeprägt »nationale« Denken ging mir ein und erfüllte mich. Schließlich waren ja fast alle Lehrer und auch die Pastoren der Stadt, die uns unterrichteten und konfirmierten, »national« gesinnt. Nicht umsonst wurde unsere kleine Stadt am Rande des Nordharzes, Wernigerode, damals die »schwarze Stadt« genannt. Das ging auf die vielen amtierenden und pensionierten Pastoren zurück, die sogar von den Kanzeln aus konservativ-politische Reden hielten und auch sonst ihren »schwarzen« Einfluss geltend machten. Das sollte wohl auf einen jungen Menschen abfärben.
Auf meiner Suche nach Kontakten und einem festeren Halt geriet ich in eine religiöse Jugendgruppe, einen Bibelkreis, zu dem auch Schüler unserer Schule gehörten. Jahrelang hoffte ich, meine Freunde dort zu finden, vertiefte mich in ihre Gedankenwelt, studierte ihre Lehren. Ja, eines Abends in der Natur war ich fest davon überzeugt, die Stimme Gottes zu vernehmen, der mich rief. Ein ungeheures Glücksgefühl durchströmte mich, ich glaubte, ein ganz anderer Mensch zu sein, »erweckt« zu sein. Aber das blieb nur kurz, die Suggestion hielt nicht lange vor, der Alltag forderte sein Recht, der graue Tag war wieder da, und nie wieder hatte ich ein ähnliches Erlebnis.
Als die Schule beendet war und ich mich dem Medizinstudium zuwenden wollte, fehlte das Geld. So versuchte ich, als »Werkstudent« einiges dazu zu verdienen. In einer Waggonfabrik meiner Heimatstadt nahm man mich an und stellte mich in einer riesigen lärmerfüllten Halle an eine Eisensägemaschine. Am Tage der offiziellen Schulentlassung stand ich schon morgens an der Maschine. Nun eilte ich, mir schnell die öligen Hände zu waschen und mich umzukleiden, um das Zeremoniell der Abschlussfeier samt Rede über mich ergehen zu lassen. Merkwürdiger Kontrast zwischen den wohlgebetteten Kameraden und mir, dem das Getöse der weiten Maschinenhalle noch in den Ohren dröhnte, als der Direktor seine Rede über die griechischen Tugenden hielt!
Kurze Zeit später stellte man mich an eine rotierende Schwabbelmaschine. Dort musste ich Eisenbahntürgriffe putzen. Dabei glitt mir einmal ein Metallstück plötzlich aus der Hand und schlug mit großer Gewalt gegen meine Brust. Mit einem Aufschrei stürzte ich zu Boden. Ich konnte kaum atmen. Die Arbeitskollegen sprangen herzu, betteten mich ruhig, halfen mir wieder auf und kümmerten sich um mich, bis der Schock nach einiger Zeit vorbei war. Wohltuend empfand ich ihre Hilfe.
Bald darauf ging ich in einer Gießerei unserer Stadt an den Kupolofen, wo wir schweratmend die Pfannen mit flüssigem Eisen trugen und mir der Funkenregen auf den in den Nacken geschobenen Hut spritzte.
Später arbeitete ich beim Stubbenroden im Forst. Es gehörte zu meinen Aufgaben, Löcher in den Boden und unter den Stubben zu graben, in die der Sprengmeister die Ladung hineinpackte. Wir flüchteten jedes mal gut fünfzig Meter hinter die Holzhaufen, dann ging der Krach los, und große Stücke flogen heraus. So tagaus, tagein, mitunter nieselte oder regnete es von morgens bis abends. Nur in den Pausen erwärmte uns ein Holzfeuerchen, an dem wir verdrießlich herumlagen und die Älteren Dinge erzählten, dass mir die Ohren rot wurden.
Als Bauarbeiter verdiente ich mir mit Kalk- und Ziegeltragen auf Neubauten die mageren, in der Inflationszeit schnell hinschwindenden Gelder. Während des Studiums arbeitete ich zeitweilig als Setzer in einer studentischen Druckerei. So kam ich arm, aber leidlich über die Runden.
Dabei merkte ich kaum, wie ich mich einer anderen Welt, der Welt der Arbeit, annäherte, neue Menschen kennenlernte, deren Sprache sprach, ihre Gedanken dachte und Gefühle empfand.
War ich auf der Hochschule anfangs noch sehr religiös eingestellt und auch Mitglied einer religiösen Vereinigung, der D.C.S.V., so bröckelte mein Glaube unter der Wucht der exakten Naturwissenschaften, die auf mich einströmten, langsam ab. Eine längere Krankheit und Gespräche mit einem fortschrittlichen Arzt zwangen mich zum Überlegen. Meine bisherige Weltanschauung war irgendwie brüchig geworden. Ich erkannte, wie viel Selbsttäuschung, Selbstbetrug ihr innewohnte, und eines Tages machte ich mich ganz frei davon.
Endlich war ich all des Ballastes ledig! Wieder spürte ich eine Welle des heißen Glücksgefühls, die mich in eine neu eroberte Welt getragen hatte. Frei und unabhängig vom Zwang des Glaubens, des Glaubenmüssens von Dingen, die der Verstand nicht wahrhaben und begreifen wollte und deshalb verneinte. Zusammen mit der Religion warf ich automatisch auch viele der konservativen Gedanken über Bord, ohne das im einzelnen schon ganz genau zu wissen. Jedenfalls versuchte ich, die Welt nun ohne Vorurteile zu betrachten, objektiv zu sein, so gut ich es vermochte.
Gewiss blieb das zum Teil feudale Treiben an den Universitäten nicht ohne Eindruck auf mich. Die begüterten jungen Leute lebten gut. Sie trugen elegante Kleidung, und wie zierlich konnten manche das Spazierstöckchen schwingen oder mit ihrem Hund promenieren gehen, die bunte Mütze keck auf dem Ohr. Sie »kneipten« in ihren Verbindungshäusern, ihren Villen, die wie ein schöner Kranz auf den Bergen der kleinen Universitätsstadt lagen, sie schlugen »Mensur« und ließen sich das Gesicht zerhacken, kamen stolz mit verpflasterten Visagen zum Kolleg und zeigten ihre »Schmisse«. Sie trugen die farbige »Couleur« der Verbindungsstudenten schräg über der Brust, sie gingen viel aus und leisteten oft wenig.
Wir »Mensastudenten« waren einfacher, oft bettelarm, so dass wir am Monatsende kaum den Groschen für das armselige Mensaessen aufbringen konnten, aber wir leisteten mehr, und das wussten wir auch. So ging das Studium mit den Examina zu Ende, und mit der ersten Anstellung in einem Hamburger Krankenhaus kam auch das erste, im Beruf selbst verdiente Geld.
Nun genoss ich die schöne Hansestadt und ihre tausend Möglichkeiten. Das Tuten der Schiffe im Hafen, das bunte Treiben und der Lärm an den Landungsbrücken, die Altstadt mit ihren pittoresken Straßen, Brücken und Bauten, Geschäften, Verkehr, das alles war für mich Binnenländer von unerhörtem Reiz. Dazu die norddeutsche, die Hamburger Sprache, das breite Platt, so anders als das Platt in meiner mitteldeutschen Heimat: ein großes Glück für mich.
Auf einem Faschingsfest lernte ich Grit kennen. Sie war mit einem grünseidenen Gewand bekleidet und tanzte leicht wie eine Feder. Ich war ein leidenschaftlicher Tänzer, und sie war für mich ein Entzücken. Wir blieben den ganzen Abend zusammen.
Am nächsten Tag rief sie mich im Dienst an. »Ihre Faschingsfee ist am Telefon« sagte eine ältere Kollegin mit missbilligendem Blick.
Grit war anhänglich. Wir wanderten zusammen durch die Lüneburger Heide, zu den Halligen an der Küste. Und wir tanzten, tanzten, so oft wir konnten. Das war für mich eine schöne, eine glückliche Zeit, fast dachte ich, sie sollte nicht enden.
Aber die drohenden Schatten der Zeit nach dem Unglücksjahr 1929 standen über uns, und keiner konnte ihnen entfliehen.
Ich lebte im Süden der Stadt Hamburg, unweit des Hafens, in Rotenburgort, einem Proletenviertel. Dort lag das Krankenhaus, an dem ich arbeitete und wo ich in einem kleinen Zimmerchen wohnte. In diesem Vorort gab es damals einige Tausend Arbeitslose. Ein unfassbarer Gedanke für mich, arbeitslos, beschäftigungslos zu sein. Was mochte in diesen Menschen vorgehen, die zu den Schlangen an den Arbeitsämtern wanderten und zum Kehricht der Geschichte gemacht worden waren? Früher hatte man sie in der Stadt ihrer Arbeit nachgehen sehen; sie beluden und entluden die großen Schiffe an den Kais, sie fuhren auf den kleinen Barkassen und Schleppern geschäftig hin und her, auf den Hauptstraßen wogte es von eilenden Menschen, sie strömten in die Fabriken oder quollen wieder aus ihnen heraus. Nun waren sie durch die Krise fast alle arbeitslos geworden, viele Fabriken hatten ihre Tore geschlossen. Ich sah diese Männer in Gruppen auf Plätzen und in den Straßen herumstehen, ihre blauen Schirmmützen beherrschten das Bild. Sie redeten, sie diskutierten, sie spielten auf den Bänken Schach, sicher langweilten sie sich.
Wir Ärzte konnten nicht unbeteiligt bleiben, mitunter wurden wir auch direkt davon berührt. Kinder, die in unsere Sprechstunde kamen, sahen in ihrer zerschlissenen Kleidung zum Erschrecken aus. Nur mühsam konnten die Mütter das Geld für Seife auftreiben, um sie sauber zu halten. Fast schämte man sich, eine Arbeit zu haben.
Und das ging wochenlang, monatelang, jahrelang, in schleppender Eintönigkeit. Wer konnte sich schon dagegen stemmen? Würde das niemals ein Ende finden? Sollte man das alles hinnehmen und tatenlos dabeistehen? Oder sich resigniert zurückziehen und versuchen, von dem verbliebenen Reichtum der wohlhabenden Hansestadt ein Stück zu ergattern? Durfte man den Ruf seines sozialen Gewissens einfach überhören? Was sollte nun werden? Viele, viele Fragen, aber kaum eine Antwort.
Ich musste begreifen, wie es zu solchem Massenelend hatte kommen können, ich musste lernen, welche Kräfte daran beteiligt waren, welche Schuld die Regierenden, die Machthaber traf, um mich dann für oder gegen sie entscheiden zu können. Das war nicht einfach, und wie durch einen weiten Nebel musste man sich durch viele Vorurteile und Überlieferungen, Verkettungen und Fesseln hindurch einen Weg bahnen, musste versuchen, von anderen vernünftigen, klar sehenden Menschen zu lernen.
Mit Grit konnte ich diese Fragen nicht besprechen. Sie hatte keinen Sinn dafür, ihr Lebenskreis, ihre Welt ließ derartige Fragen und Probleme nicht zu.
Und so kam plötzlich – ich war siebenundzwanzig Jahre alt – eine Leere über mich. Ich war der ewigen Vergnügungen satt und hatte genug von den Gesprächen über Geschäfte, über Moden, über Lokale, über all die Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten des Lebens. Ich hatte auch die glatten Kameraden, die gastfreien Familien über, die mich einluden und bei denen ich in sich selbst genügenden Gesprächen über Kunst und Musik, über Theater und andere, an der Oberfläche liegenden Dingen meine Zeit vertat. Das alles war recht nett für ein paar Stunden. Aber füllte es mich aus? Das alles ekelte mich allmählich immer stärker an. Ich sah das Elend der Arbeitslosen, und die großen Gegensätze zwischen den Armen und den ungestört in ihren Villen lebenden reichen Hamburger Kaufleuten empörten mich. Mein soziales Gefühl protestierte, mein Gewissen regte sich. Was sollte all dieser Prunk angesichts des ungeheuren gewaltmachenden Elends, das über Deutschland lag? Wie konnte das in Deutschland anders werden?
Einer meiner Freunde war Bankangestellter in Hamburg. »Weißt du, wie es bei uns zugeht?« sagte er zu mir. »Vor einiger Zeit war mein Chef in der Oper, ich traf ihn dort. In der Pause ging er ans Telefon. Dann kam er zurück und sagte aufgeräumt zu mir: ›Gerade mit Zürich telefoniert und eine Million verdient.‹ So leicht geht das! Aber als der Bankenkrach kam, da waren die Direktoren bleich und krank, sie zitterten und konnten nichts machen. Die Arbeit haben wir für sie gemacht.« Ich hörte durch diesen Bekannten auch von der Korruption und den ungeheuren Einkünften gewisser Industrieller und Mitglieder von Aufsichtsräten. Schließlich sah ich diese Schicht oft genug in Hamburg durch die Straßen rauschen, in den Luxusgeschäften sich drängen, in den eleganten Lokalen sitzen.
Zur herrschenden Schicht der Besitzenden, der Regierenden hatte ich das Vertrauen verloren. So wie bisher ging es nicht mehr weiter. Und das sagten sich in dieser Zeit Tausende und Millionen. Es blieb nur der Weg nach ganz rechts oder nach links. Rechts, wo die Besitzenden, die Nationalisten waren, war für mich kein Platz. Ich hatte sie schon in der Schule kennengelernt und gemieden. Nicht umsonst aber hatte ich das Leben der Arbeiter gekostet, wie sie geschuftet und gelebt, wie sie gebangt und gehofft, wie sie die Groschen gezählt hatten. Mein Platz war an ihrer Seite. Niemals war mir der leiseste Gedanke für den Weg der Reaktion, des Nationalsozialismus gekommen.
Illegal
In meinem südlichen Hamburger Vorort schloss ich mich einem Zirkel junger Arbeiter, Kaufleute und Intellektueller an. Ich wusste, wo diese Gruppe der organisierten Linken tagte, und ging dorthin. Mit welcher Schärfe man die politischen und wirtschaftlichen Probleme betrachtete und wie man darüber sprach, setzte mich, der ich anfangs misstrauisch war, in Erstaunen. Meine oft noch konfusen Ansichten über das Wirtschaftsleben wurden dort behutsam, aber mit Bestimmtheit zerlegt und richtiggestellt. Mitunter äußerte ich derbe Kritik, man antwortete mir sachlich und gründlich, bis meine Einwände mehr und mehr verstummten. In diesem Kreis fühlte ich mich wohl, alle waren ohne Dünkel und Standesvorurteile, aber gute Kameraden.
Man brachte mir bald das Mitgliedsbuch einer großen Partei, der kommunistischen, und ich fühlte langsam: Dies war eine neue, eine richtige Welt, die die alte auf den Kopf stürzte. Ich las grundlegende politische Bücher, bemühte mich, schwierigste Sachverhalte und die komplizierte Terminologie wirtschaftlicher Zusammenhänge zu verstehen, und vieles gelang mir. Ich war glücklich. Nachdem ich zunächst meine religiöse und reaktionäre Gedankenwelt über Bord geworfen hatte, nach Überdruss und Ekel angesichts der Oberflächlichkeit eines bürgerlich satten und galanten Lebens, war ich nun von einer unerhört starken Idee ergriffen. Und ich blieb ihr verhaftet, sie hatte meinem Leben eine Richtung gegeben.
Zunächst wollte ich mich von Grit nicht trennen, wir wanderten weiter an den Wochenenden. Ich versuchte, sie für mein neues Denken zu gewinnen, aber es war ein vergebliches Bemühen, und dann trennten wir uns.
Als mich meine weitergehende Spezialausbildung nacheinander in verschiedene Gegenden Deutschlands verschlug, suchte und fand ich jedes mal Anhänger dieser großen linken Partei. Sie war ja überall vorhanden. Ich lernte in ihren Schulungsgruppen, der »Masch«, vertiefte mich immer mehr in die Theorie und Lehren dieser Partei. Welche Tiefe, welche sachliche Gründlichkeit, welche Klarheit der Gedanken! Es war mir, als ob ich nach all dem Mief der überkommenen Anschauungen endlich reine Luft atmen würde.
Und dann war ich über Nacht aktiv geworden, arbeitete mitunter in ihren Büros, schrieb hin und wieder für ihre Blätter und redete in ihren Zirkeln. Bei meinen Berufskollegen jedoch fand ich wenig Verständnis. Sie waren zumeist in der alten bürgerlichen Welt gefangen, und mich hielten sie für einen viel zu einseitigen, jugendlich glühenden Aktiven, als dass ich Brücken des Verständnisses hätte finden können. Nur wenige meiner Kollegen waren wie ich zu Anhängern dieser Partei geworden, und wir hielten zusammen und wurden Freunde.
Wegen meiner politischen Aktivitäten musste ich zweimal meine Stellung wechseln. Mit dürren Worten sagte man mir, dass die Stellen zu knapp geworden seien oder was dergleichen Ausreden mehr waren. Ich wusste Bescheid und suchte mir etwas Neues.
Noch am Abend von Hitlers Regierungsantritt war ich als politischer Referent der Partei zu einer Versammlung gegangen. Schon Wochen vorher hatte die Polizei unsere Versammlungen kontrolliert, wir mussten unsere Pässe vorlegen, sie suchten nach Ausländern.
Hätten sie gewusst, wie aktiv ich war, mir wäre es schlecht ergangen.
Nachdem die Nationalsozialisten an der Macht waren, führte für uns, deren Gegner, der Weg in die Illegalität. Dass man mich bei den Nazis nicht kannte, war mein Glück, sonst wäre ich gleich verhaftet worden. So hatte ich noch eine Spanne Zeit.
Wie viele andere glaubte damals auch ich, dass der Nationalsozialismus durch illegale Arbeit allmählich unterhöhlt werden könne. Leonid Krassin, der einer wohlhabenden russischen Familie im zaristischen Russland entstammte und sich als Zwanzigjähriger der revolutionären Bewegung anschloss, war mir zum Vorbild geworden. Er hatte viele Jahre lang ebenso illegal gearbeitet, wie ich es jetzt vorhatte. Immer noch voller Naivität dachten wir, jahrelang durch das riesengroße, engmaschige Gestaponetz hindurchschlüpfen zu können. Trotzdem war mir in dem Moment, als ich mich zu dieser verbotenen Arbeit entschloss, bewusst, dass man mich eines Tages fangen könnte. Gut, sagte ich mir, und wenn sie mich fangen, ich kann es nicht ändern, diese Arbeit muss getan werden. Ohne Opfer ist der Kampf nicht zu führen. Glücklicherweise war ich nicht verheiratet, und die Freundin, die ich hatte, war mir kein Hindernis, Existenz und Leben aufs Spiel zu setzen. Aber ich fühlte mich nicht als Hasardeur, sondern beobachtete mit Ekel und Entsetzen die steigende Flut der Nazihandlungen, sah die faschistischen Gesetze und Verbrechen, erkannte den wachsenden stillen Widerstand nach der Machtergreifung der Nazis.
Oft unterhielt ich mich mit Freunden, und wir fragten uns, wie lange dieser nationalsozialistische Spuk sich wohl halten könne. Ein bis zwei Jahre war die Meinung der meisten, dann würde es durchlöchert werden und aufhören. Wir waren reichlich naiv!
Eines Tages wurden die »Gleichschaltung« und das »Führerprinzip« auch bei uns in der Dresdner Privatklinik eingeführt. Alle – meist waren es ja Frauen im weißen Kittel – mussten morgens im Korridor der Größe nach in zwei Gliedern antreten. Ins vordere Glied wurden die Imposantesten gestellt. Und dann kam der Klinikchef, der Professor. Die dicke Oberschwester, vor Aufregung krebsrot, meldete, sich verhaspelnd, die angetretene Belegschaft, die »Gefolgschaft«, und er erhob wohlgefällig den Arm zum Hitlergruß. Die Gefolgschaft musste ebenso antworten, dann wurde weggetreten. Alles lächelte danach darüber, und allen war speiübel davon. – Der Vorgang wurde nie wiederholt.
Wenn ich zunächst nur wenige Erfolge in der illegalen Arbeit sah, so glaubte ich doch, dass sie allein schon aus Disziplin gegenüber den Genossen, die mich dazu aufforderten, unverändert getan werden müsse, im Hinblick auf spätere, günstigere Zeiten sowieso.
Unter meinen Patienten fiel mir eines Tages eine junge Frau besonders auf. Aus ihren braunen Augen leuchtete eine solche Fülle von Licht und Schönheit, dass ich wie verzaubert war. Schöne, strahlende Menschen anzusehen, bereitet wohl jedem Freude. Auch meine Mutter war stets von solchen Menschen fasziniert, und so ging es auch mir. Das Mädchen wurde meist von ihrem Verlobten abgeholt. Wir gerieten ins Gespräch, in das wir auch ihren Verlobten einbezogen und befreundeten uns allmählich. Schließlich machten wir zu Ostern 1934 sogar eine gemeinsame Wanderung in die Berge. Der Verlobte, Gerhard Berthold, war ein junger Zeichner, in dem ich bald einen politisch ähnlich gestimmten Geist entdeckte. Er war ein frischer, natürlicher Mensch, manchmal schien er mir freilich etwas vorlaut. Auf der Wanderung sangen wir die alten Wanderlieder, und er stimmte auch manche politische Lieder an, die er noch aus früherer Zeit kannte. Das Lied der roten Flieger sang er mit heller Begeisterung, und ich höre seine Stimme noch heute: »Und höher und höher und höher, wir steigen trotz Hass und Hohn … Ein jeder Propeller singt surrend, wir schützen die Sowjetunion.« Bald heirateten die beiden Verlobten.
Als ich im Sommer 1934 von einer Auslandsreise zurückkehrte, hatte ich ein kleines Parfümfläschchen für die junge Frau mitgebracht. Berthold sagte mir kurz darauf ins Gesicht: »Es war ein billiges Parfüm«. Ich war schockiert von seinen Worten, sie trafen mich wie ein Dolchstoß in die Seite. Über Geschenke redet man doch nicht schlecht!
Warum trennte ich mich nicht sofort von ihm? Nach einer solchen Taktlosigkeit sollte man doch mit dem Menschen nicht weiter zusammen sein. Aber das Glücksgefühl, in der trostlosen Zeit damals einen politisch ähnlich gestimmten Menschen zu kennen, war zu groß. So schlug ich die innere Warnung in den Wind. Das war mein Unglück!
Damals lernte ich auch, wenn ich mich recht erinnere, durch eine Zeitungsannonce, die Thielemann, der Leiter, aufgegeben hatte, einen Kreis von »Technokraten« kennen, eine Gruppe, in der technische und wirtschaftliche Angelegenheiten mit erstaunlicher Schärfe und überraschender Erfahrung diskutiert wurden.
Wie froh war man, in einer solchen Gemeinschaft ohne Schönrednerei, ohne nationalsozialistische Verbrämung und Verfälschung unverkennbarer Tatsachen wieder einmal über ernste Dinge reden zu können, und wie begierig griff man jede Möglichkeit dazu auf.
Bald war ich mit einem Ingenieur aus den Hillewerken namens Barth, in dem ich einen Gesinnungsfreund entdeckte, etwas näher befreundet. Mit seinen tief liegenden, dunklen Augen schien er das Innere der Welt aufzuspüren. Leise verständigten wir uns über die bitteren Vorgänge um uns herum, die Gleichschaltungen, die braune Flut der marschierenden Kolonnen, die schrankenlosen Gesetzesverletzungen, die wildgewordenen Spießer in den Machtpositionen. Wie ließ sich zum Beispiel der zum »Gauleiter« avancierte Mutschmann auf seinen Jagden die Hirsche zutreiben, die er und seine Kumpane zu Dutzenden von der Kanzel herunter abschossen. Wir lachten über solch unwaidmännisches Verhalten und empörten uns über den ganzen Pomp dieser »Goldfasanen«, die durch »Arisierungen« und andere Manipulationen reich gewordenen Würdenträger und »Amtswalter«.
Peschel war der andere meiner technokratischen Freunde, ein Kaufmann; allmählich lernte ich ihn und seine Familie kennen. Zögernd fassten wir Vertrauen zueinander. Er war ernst und verbittert, wenn er vom Nationalsozialismus sprach, kühn, wenn es galt, irgend eine illegale Sache zu vollenden. Wie oft war er schon in der Tschechoslowakei gewesen und hatte Schriften über die Grenze nach Deutschland hereingeschmuggelt, hatte Leuten, die die Gestapo suchte, zur Flucht verholfen, hatte Flüchtende wochenlang in seiner Wohnung verborgen. Und wie selbstverständlich half ihm seine Frau dabei.
Es war zur damaligen Zeit in den illegal arbeitenden Kreisen Deutschlands überhaupt häufig, dass irgendein – oft unbekannter – Flüchtender oder mit illegalem Auftrag Versehener, von zuverlässigen Genossen avisiert, in den privaten Lebenskreis aufgenommen und dort für Tage und Wochen verborgen wurde. Das Risiko, von jemandem angezeigt und der Polizei übergeben zu werden, war groß, aber es fanden sich noch immer genügend Menschen, die es auf sich nahmen.
Selbst meine alte Mutter, die in einem Berliner Vorort wohnte, aus bürgerlichem Hause stammte, liberal-bürgerlich erzogen war, wie wir Kinder aber den Nationalsozialismus leidenschaftlich hasste, war zu solchem Opfer bereit. Als einer unserer guten Bekannten aus der Nachbarschaft, der alte Kommunist Rudi Reimann, der nach 1945 Bibliothekar des ZK der SED wurde, eines Tages fragte – es war 1933 –, ob nicht auch sie jemanden für eine gewisse Zeit illegal aufnehmen würde, sagte sie zu. Sie hatte das Gefühl, das ihren Kinder zuliebe tun zu müssen. Der Genosse kam, blieb wohnen, hielt sich tagsüber in der Stube auf und ging nur abends einmal weg. Mitunter besuchte ihn sogar auch seine Frau. Nach sechs Wochen musste er jedoch das Quartier wechseln. Die Nachbarn waren irgendwie aufmerksam geworden. Natürlich kam er uns dann aus den Augen. Viele Jahre später hat mir Rudi Reimann gesagt, um wen es sich bei diesem Illegalen gehandelt hatte: Es war Walter Ulbricht gewesen.
Einer von solcherart Sympathisierenden war auch Thielemann, der Vorsitzende jenes technokratischen Zirkels, ein Kaufmann in den dreißiger Jahren. Er hat übrigens die technokratische Vereinigung sehr bald selbst aufgelöst: Einige Genossen waren mit ihren Äußerungen zu unvorsichtig gewesen, sogar das Wort »Rotfront« war einmal gefallen. Außerdem vermutete Thielemann, dass die Gestapo ihre Spitzel auch in diesen Zirkel schicken würde. Mit Thielemann hielt ich weiterhin Kontakt.