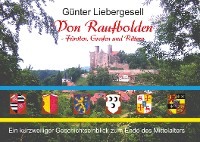Kitabı oxu: «Von Raufbolden - Fürsten, Grafen und Rittern»
Günter Liebergesell
Von Raufbolden -
Fürsten, Grafen und Rittern
Ein kurzweiliger Geschichtseinblick zum Ende des Mittelalters
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Günter Liebergesell
37308 Heilbad Heiligenstadt, Robert-Koch-Str. 5
E-MAIL: g.liebergesell@web.de
Zeichnung: Günter Liebergesell, Wappen Karl Heinz Gaebel (+)
Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Dieses Buch erscheint durch die freundliche Unterstützung von
Widmung
Vorwort
Wir schreiben das Jahr 1468…
Auszug aus der Stammtafel der Landgrafen von Hessen
Auszug aus der Stammtafel der Grafen von Gleichen-Remda
Auszug aus der Stammtafel der von Hanstein, Dittmar Linie
Auszug aus der Stammtafel der Grafen von Schwarzburg-Blankenburg
Auszug aus der Stammtafel der Wettiner
Literatur
Weitere Bücher
Dieses Buch erscheint durch die freundliche Unterstützung von
Heimatverein Hanstein/Bornhagen e. V.
Am Kulturzentrum 11
37318 Bornhagen
Telefon: (036083) 42695
Internet: www.burghanstein.de

Das große mittelalterliche Burgfest, auf der Burgruine Hanstein, immer am ersten Wochenende im August.
Familie Röhrig
Friedensstraße 28
37318 Bornhagen / Eichsfeld
Internet: www.klausenhof.de
Telefon: (036081) 61422

Ritteressen u. a. histor. Tafeleyen
Ausgezeichnete regionale Küche
Historische Herberge
Radfahrerherberge
Wurst-und Hausschlachtemuseum
Veranstaltungen auf Burg Hanstein
Gesellschaften bis 250 Personen
Silvia Rinke
Schanze 6
37318 Bornhagen
Telefon: (036081) 67134
Fax: (036081) 68964
E-Mail: rinke-s-g@t-online.de

Silvestris – Medieval Services
Dienstleistungen rund ums Mittelalter am Fuß der Burg Hanstein
Gewandschneiderei, Burgführungen
Meiner Frau Angela in Dankbarkeit gewidmet
Vorwort
Die Mitte des 15. Jahrhundert war der Anfang vom Ende des Spätmittelalters, die Zeit, in der ein umfassender kultureller und sozialer Wandel zur Neuzeit einsetzte.
Diese Zeit lässt sich nicht einfach in eine Schublade stecken, nein, sie besitzt eine so große Vielfalt an Ereignissen, dass man sie mit Fug und Recht als Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit bezeichnen kann. Es war eine im höchsten Maße gewalttätige Epoche mit unzähligen Kleinkriegen und Fehden, Überfällen und Raubzügen, die das Bild bestimmten. Es wurden viele verlustreiche Kriege geführt, wie fast immer durch die Entwicklung neuer Kriegstechniken begünstigt.
Die individuelle Rechts- und Machtregelung, wie das Fehderecht, förderten diese Entwicklung noch, bis Kaiser Maximilians I. auf dem Reichstag zu Worms, im Jahr 1495, das Fehde- und Faustrecht verbot und den weiteren Gebrauch desselben als Landfriedensbruch erklärte.
Neue Machtzentren entstanden durch die Entwicklung von Wirtschaft und Handel und Familien, wie die Fugger und die Medici, wurden so unglaublich reich, dass sie zum Teil die europäische Politik beherrschten. Die Kirche steckte in einer tiefen Krise, die Menschen versuchten zwar durch Seelenmessen, Ablässe, Wallfahrten oder durch zahllose Stiftungen den Himmel für sich zu erwerben und waren wohl auch zu keiner anderen Zeit so fromm und gottesfürchtig wie am Ausgang des Mittelalters und doch beherrschte ihr Leben Angst und Sorge. Sie wurden gepeinigt durch Alpträume, Teufel und Dämonen. Seuchen und Katastrophen kündigten für sie das sichere Ende der Welt an. Doch waren sie mehr Angepasste und Unterwürfige als Gläubige.
Die Machtstellung der Kirche wurde geschwächt und sie reagierte durch Stärkung der Inquisition, als Mittel zur Unterdrückung von Abtrünnigen und Andersgläubigen darauf, was nicht gerade ein christlicher Umgang mit Menschen und wahrlich keine zu bejubelnde Charaktereigenschaft von ihr war.
Das Große Abendländische Schisma, die Kirchenspaltung, konnte durch Papst Nikolaus V. beendet werden, doch die kleineren Kirchenfürsten schlugen sich weiter die Köpfe ein, in ihrer Gier nach Macht und Pfründen. Eine große Landflucht zog sich durch das gesamte Spätmittelalter und hinterließ ein furchtbares Bild auf der Landkarte Europas. Aus etwa 40.000 Siedlungen, im Gebiet des Reiches, zogen die Menschen fort und hinterließen Wüstungen. Städte wurden immer beliebter und die Bevölkerungszahl begann in ihnen zu explodieren. In den Städten galt der Grundsatz „Stadtluft macht frei“, so waren alle Stadtbewohner freie Bürger, wenn sie ein Jahr und einen Tag unbehelligt in einer Stadt lebten.
Doch waren sie wirklich FREI und wie sah ihr LEBEN aus?
Erste Reformbewegungen flackerten auf und durch die Lehren von John Wyclif in England und Jan Hus in Böhmen, brach in den Köpfen der Menschen ein neues Bewusstsein hervor. Dieses Aufkeimen führte in den kommenden Jahrzehnten zu einem radikalen Wandel in ganz Europa, bis hin zur Reformation und Bauernaufständen.
Die Krieger mit den Krummsäbeln des Osmanischen Reiches hatten 1456 Konstantinopel erobert und so das oströmische Reich beendet und drangen langsam aber stetig ins Christliche Abendland vor und mussten abgewehrt werden.
Dank der genialen Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg wurde es möglich, die mühselige Arbeit der Kopisten durch die schnelle und billige Vervielfältigung zu ersetzen und es entwickelte sich so eine Zeit der Aufklärung.
Nationalstaaten und viele einzelne Territorialstaaten entstanden. Und auch in der Mitte Deutschlands, in unserer Region, geriet so manches in Bewegung.
Wenn man sich nun daran macht, einen Abriss der Geschichte in einer kurzen Zeitspanne und einem kleinen Gebiet zu zeichnen, ist es sicher nicht das Dümmste, sich die Frage zu stellen: „Wer waren denn eigentlich die Akteure?“
Da es sich hier um einen Geschichtseinblick in einen relativ kurz bemessenen Zeitabschnitt handelt, bekommt man ein exemplarisches Bild von den Zuständen, den Sitten, vom Leben und den Gebräuchen der Ritter, Fürsten und Herrn dieser Epoche.
Dieses Buch soll an Hand einiger Personen, die wir ein Stück ihres Lebensweges begleiten, einen kleinen Einblick geben in eine Zeit der Veränderungen.
Es will versuchen in die Verflechtungen, Beziehungen, Verbindlichkeiten, ja in viele Verstrickungen Licht in das Dunkel der Geschichte zu bringen.
Ob es gelingt? Ich hoffe es.
In diesem Buch habe ich auf die üblicherweise begleitenden Fußnoten verzichtet. Besondere Nachweise erfolgen im Text, die benutzte Literatur befindet sich am Ende des Buches. Den Mitarbeiterinnen der Stadt- und Kreisbibliothek Heilbad Heiligenstadt sage ich aufrichtig Dank, sie besorgten mir viele Bücher, die ich für diese Arbeit benötigte.
Besonders möchte ich Herrn Prof. Dr. Harm von Seggern, von der Uni Kiel, Dank sagen. Seine Informationen aus dem Niederstadtbuch der Hansestadt Lübeck und den Bergenfahrern, betreffend Werner von Hanstein, waren mir eine große Hilfe.
Herzlich möchte ich auch meiner Frau danken für die Fahrten an die Orte des Geschehens, für das Verständnis, das sie mir bei dieser Arbeit entgegenbrachte und für die vielen Stunden, die ich am PC arbeitete und ihr stahl.
Dem Leser wünsche ich ein paar interessante und kurzweilige Seiten.
Folgen Sie mir nun in das Jahr 1468 auf die Burg Hanstein.
Günter Liebergesell

Wir schreiben das Jahr 1468, und zwar den 15. März, als ein völlig erschöpfter Bote des Grafen Erwin V. von Gleichen, aus der Linie Blankenhain-Remda, ein versiegeltes Schreiben an den Ritter Werner von Hanstein, auf dessen Burg, übergab. Werner erbrach das Siegel, öffnete das Schreiben und las.
Zornesröte muss in seinem Gesicht aufgestiegen sein, als er die Zeilen und die Zeichnung in sich aufnahm.
Im Hessischen Staatsarchiv in Marburg, Bestand 2: Auswärtige Beziehungen Grafen von Gleichen. Dokument 15, finden wir dieses Schreiben in dem folgendes steht:
„Werner der sich Ritter von Hanstein nennt. Wir haben dich oft und vielmals gemahnt, dass du dem Wortlaut deiner Verschreibung gemäß nach Mühlhausen in Leistung einreiten sollest, was du aber bisher nicht getan hast; - und dies, obwohl du uns sehr häufig angeboten und zugesagt hast, du wollest deine Briefe und Siegel wie ein rechtschaffener Mann halten. Darin hast du bislang gelogen wie ein zuchtloser, rotbärtiger, roter Ritter1, Schalk und Bösewicht, der treubrüchig an seinem Eid, Brief und Siegel wird. Nun wurden wir unterrichtet, dass dich eine Hure aus der Metergasse zu Erfurt in der Wiege verwechselt habe, denn wärest du ein Sohn der ehrsamen Frau, wie du dich rühmst, würdest du deine Treue, Briefe und Siegel uns gegenüber nicht vergessen. Wie dem auch sei, wir mahnen dich, rotbärtiger, roter Ritter, lügenhafter Schalck und Bösewicht, dass du von Stund an ohne jegliche Verzögerung nach Mülhausen in das Wirtshaus mit dem Namen Stockleib einreitest, und dort solange nicht hinausgehst, bis uns das Hauptgeld, die Zinsen und der Schaden gänzlich entrichtet worden sind. Hättest du dein Siegel einer Mähre vor ihre Fotze gedrückt, wäre dir solches viel nutzbringender gewesen, als dass du uns damit betrogen und uns das unsere abgeluchst hast. Und wenn du jetzt nicht in Leistung einreitest, so wollen wir dein ‚Lob’ ausbreiten, welches wir überdies alsbald rügen lassen. Ausgestellt unter unserem rückseitig aufgedrückten Siegel am Montag nach Reminiscere im achtundsechzigsten Jahr.“ 2
Es handelt sich hier um einen sogenannten Schmähbrief mit Schandbild. So ein Schmähbrief diente im späten Mittelalter als Rechtsbehelf, wenn ein Schuldner seine Schuld nicht begleichen wollte oder wenn ein Beschuldigter sich seinem Richter entzog oder ein gefälltes Urteil gegen ihn nicht durchgesetzt werden konnte. So war die öffentliche Verunglimpfung des Gegners für den Geschädigten mitunter ein letzter, oftmals schon ein verzweifelter Versuch, doch noch zu seinem Recht zu kommen.
Ein solcher Schmähbrief war kein stumpfes Schwert, wie man vielleicht meinen mag, ganz im Gegenteil. Kam es doch dem Beschuldigten darauf an, möglichst unbeschadet an Ehre, Leumund und Ansehen zu bleiben. Nun war aber nicht Werner von Hanstein der Schuldner, wie sich in Recherchen herausstellte, sondern sein Dienstherr der Landgraf Ludwig II. von Hessen. Werner fungierte hier nur als Bürge wie einige andere. Irgendwie kommt einem das bekannt vor.
Doch was brachte den Grafen so auf, um einen derart scharfen Brief an den Bürgen zu schreiben.
Schauen wir doch mal hinter die Kulissen und erkundigen uns zuerst einmal über die handelnden Personen und die Ereignisse der Zeit, damit wir das Geschehen auch richtig verstehen können.

Beginnen wir mit dem Grafen Erwin V. von Gleichen. Die Grafen von Gleichen gehörten zu den alten Adelsfamilien Thüringens, von denen es einige gab. Nach ihrem Stammsitz Tonna bei Gotha nannten sie sich zuerst, wie sollte es auch anders sein, Grafen von Tonna.
Sie traten schon sehr früh in den Dienst der Erzbischöfe von Mainz und erwarben im Jahr 1120 die Vogtei über Erfurt. Die Grafen von Tonna hatten die weltliche Vogtei, die Vizedome von Apolda standen der kirchlichen Vogtei vor. Nun ergab es sich, dass ihre Macht im Gefolge der Erzbischöfe von Mainz so groß wurde, dass man in ihnen die Konkurrenten der Landgrafen von Thüringen sehen konnte, denn ohne ihre Zustimmung konnten in Erfurt keine Entscheidungen getroffen werden. Lambert II. wird in einigen Kaiserurkunden des 12. Jahrhunderts sogar als Graf von Erfurt bezeichnet, obwohl es diesen Titel nie gab (so etwas werden wir später bei den Hansteinern auch noch einmal sehen).
Nach und nach verfügten sie über umfangreichen Grund- und Lehnsbesitz, vor allem in der Umgebung von Erfurt und im Eichsfeld und das mit mehreren Burgen.
1130 belehnte der Mainzer Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken, Graf Erwin II., mit der Burg Gleichen bei Gotha, nach der sich die Grafen nun ab 1162 nannten.
Ständige Auseinandersetzungen und Fehden sowie die weit zerstreut liegenden Gebiete plünderten den Geldbeutel der Grafen von Gleichen. Auch für einen Herrn Grafen gab es damals noch keine Kilometerpauschale. Die Zeit verging und die Grafen von Gleichen fielen gegenüber Mainz in Ungnade. Und wenn man in Ungnade gefallen ist, beginnt alles um einen herum zu bröckeln. Sie mussten sich dem Rat von Erfurt unterordnen. Welche Schande! Und ihre Schulden wuchsen ins Unermessliche.
Heinrich IV. von Gleichenstein kam im Jahr 1293 durch Erbschaft in den Besitz des größten Teiles der Grafschaft und aller eichsfeldischen Besitzungen. Er übernahm dadurch aber auch eine hohe Schuldenlast, die es nur für ein Jahr zuließ, sich als Burgherr zu behaupten. Um diese Schuldenlast zu begleichen, zwang man ihn, seine beträchtlichen Besitzungen im Eichsfeld an Mainz abzutreten. Am 13. November 1294 kaufte der Mainzer Erzbischof Gerhard II. von Eppstein, sein Geldbeutel war prall gefüllt, den ganzen eichsfeldischen Besitz der Grafen von Gleichen mit den Ämtern Gleichenstein, Scharfenstein und Birkenstein, südlich von Birkungen, für 1100 Mark feinen Silber und 500 Mark Freiberger Silber nach Erfurter Gewichten. Was für ein Schnäppchen.
Der Thüringer Landgraf und Markgraf von Meißen, Albrecht II., der Entartete, hatte schon 1287 seine Rechte am Eichsfeld auf den Erzbischof von Mainz übertragen. Für das Erzstift war dies der größte Gebietszugewinn, den es je getätigt hat.
Den Grafen von Gleichen blieb nichts anderes übrig, als sich ein kleines aber feines, in sich geschlossenes Gebiet zwischen Ohrtruf und Wandersleben, so wie ein Schrebergärtchen, zu schaffen. Eine Nebenlinie, die des in diesem Buch handelnden Grafen Erwin, besaß die Herrschaften Blankenhain, Niederkranichfeld und Remda. Drei seiner Verwandten nahmen an der wohl bedeutendsten Schlacht während der Hussitenkriege im Königreich Böhmen, am 16.Juni 1426 bei Aussig teil und blieben mit etwa 12 000 Gefallenen, der von Markgräfin Katharina organisierten Truppen aus Meißen, Thüringen, Sachsen und der Oberlausitz, auf dem Schlachtfeld. Es waren der General des thüringischen Fußvolkes Graf Ernst IX. von Gleichen, Herr zu Tonna, der Generalleutnant Friedrich von Gleichen-Blankenhain, und Graf Erwin VI. von Gleichen-Blankenhain.
Die Grafen von Gleichen waren wieder zu einem gewissen Wohlstand gekommen und standen in gutem Ruf, Kredite zu gewähren bzw. sie zu vermitteln. Dieses tat Graf Erwin V. von Gleichen zu Blankenhain/Remda auch.

Genau in diese Zeit um 1460 fällt ein Ereignis, was den Geldmarkt durcheinander brachte, die erste große monetär bedingte Inflation. Die Kassen der Königshäuser waren leer und das Silber wurde knapp, so wurden besonders in Österreich und Bayern größere Stückzahlen von Pfennigen geprägt, die stark kupferhaltig und somit minderwertig waren. Die Kursentwicklung galoppierte, ja überschlug sich fast. Hier drei Beispiele zum ungarischen Goldgulden: Um 1455 kostete der Goldgulden 240 Pfennige, Ende 1458 waren es 300 Pfennige und im April 1460 mussten 3.686 Pfennige für einen Goldgulden getauscht werden. Diese Geldentwertung hatte eine dramatische Preissteigerung bei Brot, Salz und Mehl zur Folge und sie wurden für viele Bürger unbezahlbar. Es kam zu Hungersnöten und Aufständen. Für die Bevölkerung war das eine schockierende und völlig neue Erfahrung. Bisher gab es Preisanstiege durch Missernten oder solche, die durch kriegerische Ereignisse ausgelöst wurden. Nun war die Münzverschlechterung für die Preissteigerungen verantwortlich und das ging soweit, dass niemand mehr die kupfernen Pfennige annehmen wollte.

Kein geringerer als der Landgraf Ludwig II. von Hessen benötigte, für seinen Lebenswandel, wieder einmal dringend Geld. Eins soll bemerkt werden, er war kein Grieche, aber Fässer ohne Boden gab es auch damals schon. Ludwig hinterlegte beim Grafen Erwin als Sicherheit eine ganze Reihe von Kleinodien und Anfang 1466 übertrug ihm Ludwig pfandweise für den Zeitraum von zehn Jahren die Burg und das Amt Bilstein bei Eschwege.
Die Gelder, die er sich geborgt hatte, reichten nicht lange und schon im Mai 1466 stand er wieder als Bittsteller an des Grafen Tür und erflehte einen Betrag in Höhe von 2600 Goldgulden. Ein Zinssatz von 7,7 % wurde vereinbart, der am Michaelistag jedes Jahres fällig war. Für den Landgrafen verbürgten sich die folgenden Personen:
Graf Wolrad I. von Waldeck.
Der aus altem hessischen Adel stammende Sittig von Holzheim, der schon unter Ludwig I. Rat in Kassel war.
Hartmann Schleier, der ebenfalls schon für Ludwig I. tätig war.
Georg Riedesel zu Eisenbach, genannt Jörge, der mit seinem Bruder Hermann III. mit dem Erbmarschallamt von Hessen belehnt war.
Philipp von Berlepsch, ebenfalls aus hessischem Adel, der das hessische Erbkämmereramt innehatte.
Und Werner von Hanstein, ein Ritter aus dem Eichsfelder Uradel, der ein hohes Ansehen bei Ludwig II. genoss.
Der Graf von Gleichen mag wohl gedacht haben, mit solchen Bürgen kann dir nichts geschehen. Weit gefehlt. Als am 29. September 1466 keine Zinszahlungen bei ihm eingingen, wartete er noch ein paar Tage und schrieb dann Anfang November einen Brief an den Landgrafen Ludwig II. von Hessen mit der Bitte, er möge doch seinen Verpflichtungen nachkommen. Ebenso ließ er auch den Bürgen einen solchen Brief zukommen. Der Landgraf, dieses Schlitzohr, schrieb an alle Beteiligten, dass er ein Treffen am Hof in Kassel plane, bei dem über alles gesprochen wird. Es tat sich nichts. So verlagerte der Graf seine Aktivitäten auf die Bürgen und forderte sie auf, am Dreikönigstag 1467 mit je einem Knecht und zwei gerüsteten Pferden in die Herberge des Hans Stoglib in der Pfortengasse in Mühlhausen, unweit der Marienkirche und der sogenannten Brot- und Fleischbänke, an denen die Bäcker und Fleischer ihre Waren anbieten konnten, zu erscheinen und so lange zu bleiben, bis die volle Kreditsumme an ihn zurückgezahlt sei.
Wieder geschah nichts. Das Aussitzen von Problemen war damals und ist auch heute noch ein sehr beliebtes Instrument der Politiker und Menschen in Machtpositionen.
Briefe wanderten hin und her, ohne Erfolg. Dann drohte Graf Erwin von Gleichen, wenn der Landgraf nicht seine Schulden am 8. März in Mühlhausen begleiche, werde er die ihm überlassenen hessischen Kleinodien zu einem möglichst hohen Betrag verkaufen oder versetzen.
Das war wie ein Bienenstich für den Landgrafen. Er wetterte wie ein getretener Hund, es stehe dem Grafen nicht zu, die Kleinodien einzulösen, dazu seien lediglich der Herzog Wilhelm von Sachsen oder sein Bruder Heinrich, der Landgraf von Oberhessen befugt. Außerdem sei es für ihn, einen Fürsten des Heiligen Reiches, die vornehmste Aufgabe Recht zu gewähren und zuzugestehen. Einen Fahrplan, wie er die Schulden aus der Welt schaffen wollte, blieb er aber schuldig. Ja, er verschärfte den Konflikt noch, in- dem er dem Grafen von Gleichen das Amt Bilstein entzog.

Zeichnung: Günter Liebergesell
Graf Erwin blieb wieder einmal nichts weiter übrig, als Briefe zu schreiben und um Treffen mit den Gläubigern zu bitten. Es muss sogar eine Besprechung im Sommer 1467 in Spangenberg stattgefunden haben, wann, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde beschlossen, dass die Rückzahlung der Schulden und Zinsen im Laufe des Jahres erfolgen soll, genaueres aber noch festgelegt werden muss.
Es kehrte Ruhe ein bis Anfang 1468. Als Erwin im März 1468 immer noch auf sein Geld wartete und das Schreiben der vielen Briefe und Mahnungen sich als völlig sinnlos herausstellte, riss ihm der Geduldsfaden und er griff zu schärferen Waffen, den illustrierten Schmähbriefen, die er den Bürgen mit Boten zukommen ließ.
Keinem Ritter oder Grafen hätte es gefallen, öffentlich verschmäht zu werden, doch für den Gläubiger war es oft, wie schon erwähnt, die letzte Möglichkeit zu seinem Recht zu kommen.
Den Text haben wir schon gelesen, an ihn schließt sich eine kolorierte Federzeichnung an, die den anstößigen Text aufgreift und ins Bild setzt. Übernehmen wir die Beschreibung von Matthias Lentz aus seinem Buch „Konflikt, Ehre, Ordnung – Untersuchung zu den Schmähbriefen und Schandbildern des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit“ dort heißt es: „Sie zeigt einen blau-weiß gekleideten Mann, der verkehrt herum auf einer nach links trottenden braun-grauen Mähre reitet. Obwohl die an der Ferse seines rechten Schnabelschuhs sichtbaren Radsporen den ungewöhnlichen Reiter als Angehörigen des Ritterstandes ausweist, steht die farbliche Zweiteilung seiner Kleidung („Miparti“) …“, (Die Farbteilung zeigt das Abhängigkeitsverhältnis des Trägers und wurde von Bediensteten getragen.) „… in diametralem Gegensatz dazu und kennzeichnet ihn als einen Menschen, der mit seinem abweichenden Verhalten die soziale Ordnung gestört hatte und aus der Gemeinschaft ausgegrenzt und geächtet wurde. Dass eine solche zwiespältige Person der Ordnung die Unordnung vorzieht und alles Geordnete ins Gegenteil pervertiert, spiegelt darüber hinaus das umgekehrt Sitzen auf dem Pferd wider. Der Oberkörper des außerhalb der Ordnung stehenden Edelmanns ist zum Hinterteil des Rosses vornüber gebeugt. Gerade ist er im Begriff, mit seiner rechten Hand den Schwanz des Tieres ein wenig anzuheben, um mit der linken unverzüglich seinen Siegelring vor die Scheide des Tieres zu drücken. Eine um die Darstellung herum geschwungenes Spruchband legt dem Verunglimpften dabei zusätzlich folgende Äußerung in den Mund: „Das ich mein Siegel dieser Mähre vor seine Spalte drücke bewirkt, dass ich meinem Herrn, Graf Erwin von Gleichen, meine Briefe und Siegel nicht halte.“
Das hat Wirkung, große Wirkung, auch auf Werner von Hanstein. Er schickte das Schreiben des Grafen mit der Bitte, die Schulden zu begleichen oder er werde nach Mühlhausen reiten, so wie es der Graf gefordert hat, bis alle Schulden beglichen sind, nach Kassel zu Landgraf Ludwig II.
Den Landgrafen kümmerten die Gewissensbisse seiner Bürgen nicht und er tat auch nichts, um die leidige Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Werner von Hanstein mahnte zwar den Landgrafen an, handelte aber nie gegen seine Verweigerungspolitik und stand stets loyal zu seinem Herrn.
Graf Erwin V. von Gleichen schrieb erneut am 27. Mai 1468 einen Brief an den Landgrafen von Hessen. Diesmal bat er den Landgrafen nicht, seine Schulden zu begleichen, sondern informierte ihn lediglich, dass er die hessischen Kleinodien, darunter soll laut Rommel auch die mit Edelsteinen besetzte Landeskrone gewesen sein, für 500 Gulden bei den Juden versetzt hatte. Die jüdischen Pfandleiher möchten sie nicht länger behalten und er, der Landgraf, habe die Möglichkeit, den Schmuck bis zum 16. Juni, zu Fronleichnam, einzulösen. Löse der Landgraf die Kleinodien nicht ein, so werden die Juden sie anderweitig zu Geld machen, was sie, da Ludwigs Geldbeutel ein großes Loch hatte und er seinen Verpflichtungen beim besten Willen nicht nachkommen konnte, auch taten.
Aus einem undatierten Briefentwurf an einen nicht genannten Adligen erfahren wir etwas über die Reaktion des Landgrafen auf die Ereignisse. Matthias Lentz schreibt in seinem Buch weiter: „In aller Ausführlichkeit beharrt er, der Landgraf, auf seiner eigenen Sichtweise der Zwistigkeit und dreht die Beschuldigungen einfach um. Es sei der Graf von Gleichen gewesen, der von ihm, dem Landgrafen, etlich gelt und gnade empfangen und der dafür seinerseits Briefe, Siegel und Eide gegeben habe. Doch dieser Zusicherung hätte Erwin nie befolgt, er sei nicht einmal einer schriftlichen Einlassung, was er dem hessischen Landgrafen von Ehre und Recht wegen pflichtig wäre, nachgekommen. Hieraus sei ersichtlich, dass der von Gleichen sich mutwillig den Zusagen entziehe und vor all dem, was Recht ist, fliehe. Er, Ludwig, aber habe sein eigenes Verhalten einzig und allein daran auszurichten, wie wortgetreu die Abmachung von seinem Vertragspartner befolgt werde. Aus diesem Grund weise er alle an ihn gerichteten Forderungen zurück, denn die Schrift sage“ frangenti fidem fides frangatur eidem“ – Dem Treubrecher braucht die Treue nicht gehalten werden.“
Das war’s, für den Landgrafen war damit die leidige Angelegenheit beendet.
Schluss, Aus, Ende und Vorbei.
Bis zu seinem Tod im November 1471 zahlte der Landgraf dem Grafen von Gleichen die Schulden nicht zurück. So dass der Graf bei den Kindern Ludwigs weiter klagen musste. Ob er aber je etwas zurück bekommen hat, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall brach der Graf alle weiteren Beziehungen zu Hessen ab, was nur verständlich war.
Für Werner von Hanstein zahlten sich die treue Haltung zu seinem Landgrafen und die erduldete Schmach aus. Er wurde im Oktober 1469 Geheimer Rat des Landgrafen Ludwig II. von Hessen. Nun hat Geheimer nichts mit geheim zu tun, ganz im Gegenteil, die Bedeutung des Titels leitet sich von einer früheren Nebenbedeutung des Wortes „geheim“ ab, welches wir mit „vertraut“ ersetzen können. So war der Geheimrat also der Vertraute, der ins Vertrauen gezogene Ratgeber seines Herren. Und zwei Monate vor dem Tod Ludwigs wurde Werner die Würde eines Marschalls am hessischen Hof verliehen. Er hatte es geschafft, war ganz oben oder wie es Karl Ludwig Philipp Tross, 1825 in seiner Zeitschrift „Westphalia“ schrieb: „Ein Zeitlicher Marschall war die erste Person des Landes, ungefähr was ein Burggraf war in seinen Grenzen unter den Rittern und Vasallen. Er wurde mit seinem Amte lebenslänglich belehnt; sein Amt war aber nicht erblich."
Lange hatte Werner das Amt nicht inne, denn der Landgraf Ludwig II. starb schon im November 1471.

Schauen wir uns Hessen in dieser Zeit etwas genauer an und werfen einen Blick auf den Landgrafen bzw. auf die Söhne des Landgrafen Ludwig I. Als Ludwig I. von Hessen, genannt der Friedsame, am 17. Januar 1458 starb, hinterließ er seinen fünf Kindern, Ludwig, Heinrich, Hermann, Elisabeth und Friedrich ein Reich ohne geregelte Nachfolge. Auch heute bringt so etwas nur Frust und Verdruss.
Pulsuz fraqment bitdi.