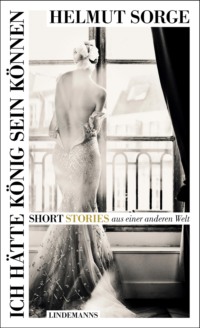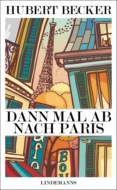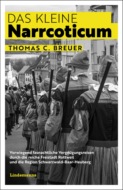Kitabı oxu: «Ich hätte König sein können»

für Axel Ganz und Renate
sowie Anna Siewert,
Freunde fürs Leben
Helmut Sorge
Ich hätte
König sein
können
Short Stories
aus einer anderen Welt
Lindemanns
Die erwähnten Personen und Gegebenheiten
entsprechen mehrheitlich nicht der Wirklichkeit.
Zufällige Ähnlichkeiten sind eben das: zufällig.
Signore Sorge da Eppendorf
Ich hätte König sein können, zumindest ein kleiner Monarch, ohne Untertanen. Ihre königliche Hoheit und ich. Durchlaucht, das wär doch was!
Ja, ich hatte eine Freundin, die war Prinzessin und gelegentlich entdeckte ich sie beim Durchblättern der „Gala“ oder „Bunten“. Ich war nie auf dem Foto zu sehen. Warum auch? Adel bleibt unter sich, und ich war nun wirklich einer aus dem Kohlenkeller, einem Haushalt, in dem Schlager von Vico Torriani oder Lale Andersen jene Klassiker von Giuseppe Verdi oder Johannes Brahms erdrückten. Also ein Kulturloser der Masse – Karl May statt Heine oder Goethe. Na ja, Grimms Märchen. Erich Kästner. Selma Lagerlöf, die Wildgänse in mein Leben fliegen ließ.
Meine Geliebte, sie war tatsächlich eine Cousine der Queen, der echten, der britischen. Ich war bei ihr im Palast zum Tee, allerdings hat die ewige Elizabeth davon nie erfahren. Ein Freund aus ihrem Beraterstab, auch kein Adeliger, aber immerhin ein berittener Gardeoffizier, hatte mich in sein Büro im Buckingham Palast eingeladen, weil meine Geliebte mit einem Verehrer aus dem gemeinen Volk offiziell nicht auftreten wollte. Ein Arbeiterkind hatte eine bessere Perspektive in der Fremdenlegion als im britischen Adel. Also blieb ich inkognito, trat in den Schatten, sobald Fotografen geortet wurden. In Wimbledon hockte sie in der königlichen Loge und ich auf einer Pressebank, zusammengedrückt von einem Finnen, der nach Matjes und Schnaps roch, und einem Japaner, der auf seinem Schreibmaschinenkoffer saß, weil er sonst außer der Rolex-Werbung vom Center Court nichts gesehen hätte.
Ja, wäre ich ein königlicher Typ, zumindest Hollywood-gestempelt, gewesen, säße ich mit meiner Adeligen in der Loge, direkt neben einer nachgeblondeten, königlichen Hoheit, die Lutschbonbons durch den Mund schob, denn Tennis interessierte sie nicht wirklich. Wer weiß, mit welchem Zauber sie den echten Herzog aus dem Gleichgewicht geschreckt hat? Aber sie hockte da oben und ich weiter unten, und meine Prinzessin würde mich nie vorführen. Verführt hatte sie mich bereits, und das war wirklich königlich.
Gelegentlich löste sich mein Monarchenmädel aus der adeligen Ethik und erklärte mir, ich müsse sie zu einem Cocktail begleiten. An der Tür zum Saal stand ein Mann, zwei Meter hoch, uniformiert und mit derart vielen Orden bestückt, dass er vermutlich bereits im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg für die Monarchie seinen Kopf hingehalten hat. Meine Hoheit reichte ihm die goldgedruckte Einladung, die teuerer war als
die Schuhe, die ich trug, obwohl die in der Jermyn Street so viel kosten wie ein Kaschmir-Anzug mit Weste bei Armani.
Der Ordensritter blickte, via Monokel rechts, auf die Karte, klopfte auf den massiven Holzboden und bellte auf den Höhen eines Rekrutenschänders: „Ladies and Gentlemen, her Royal Highness, the Princess of Wonderful.“ Dann betrachtete er mich, zeigte aber keine Abneigung, Mitleid oder Verachtung in seinem von dunklem Guinness aufgeblasenen Gesicht, blickte auf meinen Namen, beobachtete das nun schweigende, in Erwartung schwelgende Partyvolk und rief: „Und ... Herr ... Sorge.“
Kein armes, verlorenes „von“, nicht Graf oder erbärmlicher Fürst, nur Banalität. Zumindest Helmut hätte er hinzufügen können. Oder il Signore Sorge da Eppendorf. Ein Stadtteil, in dem ich, trotz Abwurfs britischer Bomben, anno 1942, geboren wurde. Mit Bill Gates hätte es anders ausgesehen, aber der hatte seine Computer noch nicht erfunden, als ich bereits die Prinzessin bettete und davon träumte ihr König zu sein.
Arbeit bringt nur Falten ins Gesicht
Meine Prinzessin Wonderful war wirklich eine außergewöhnliche Person. Sie sprach Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch, war eine begnadete Skiläuferin und sie brachte einen unangenehm angeschnittenen Aufschlag übers Netz. Nicht wirklich überraschend. Sie musste in ihrem Leben nie arbeiten. Warum auch? Arbeit bringt nur Falten ins Gesicht und Schwielen auf die Hände. Ihr königlicher Vater war nicht eben großzügig, aber Antoinette geriet ohnehin meist nur an Männer, die Privatflugzeuge chartern konnten oder besaßen; und wenn die Jets groß genug waren, dann heiratete sie auch beherzt. Fremde Pässe waren willkommen. Da ich nicht einmal ein antiquiertes Modellflugzeug besaß, musste ich keine Ehe befürchten, und eine solche hat sie mir auch nie angetragen.
Ich traf sie erstmals bei einem Freund in Covent Garden, einem wunderbaren Menschen, kultiviert, charmant, humorvoll. Und Ire obendrein. Ich muss mich korrigieren: Möglicherweise war er Schotte, spielte allerdings kein Golf, trug nie einen Kilt, jene unerotischen Männerröcke, und bevorzugte Cognac statt Whisky. Wir hockten bei George in der Küche und er kochte selbst, obgleich er bereits Minister in der britischen Regierung war. Überdies war er Weinexperte und konnte einen Château Rothschild von allen anderen Châteaux unterscheiden, das heißt den Rotwein, was für seine Nase und/oder seinen Kontostand spricht. George konnte Shakespeare rezitieren, den Hamlet, der ungekürzt auf der Bühne wohl um die vier Stunden benötigt. Er hat Orson Wells gekannt und sogar Hemingway getroffen, worum ich ihn beneidete. Nein, nicht bei einer Lesung, shame on you! Entenjagd. In Venedig und zu Tisch mit „Papa“ in der „Locanda Cipriani“ auf Torcello. Hemingway und Venedig – my kind of town.
Der greise Lord hatte mich nicht alarmiert, dass eine echte Prinzessin am Tisch sitzen würde, weil er sie als relativ unzuverlässig in ihren gesellschaftlichen Pflichten kannte und nie sicher war, ob sie auftreten würde, allein, oder womöglich begleitet von ihrem Cousin, dem ältesten Sohn der Queen. Der darf sich eher Hoffnung machen als ich, eines Tages König zu werden, obwohl Mom, inzwischen 90 plus auf dem Tacho des Lebens, ihn womöglich überlebt. Antoinette kam solo und war elegant und vergnügt. Sie aß mit den Fingern, wenn ein Pfifferling vom Salat auf die gestärkte Leinendecke glitt. Wir waren zu viert. Ich hätte es nahezu vergessen.
Die stilvolle italienische Ehefrau des Gastgebers sprach Englisch mit venezianischem Akzent, den ich, zugegeben, erst erkannte, nachdem ich sie gefragt hatte, ob sie in Venezuela geboren sei, heute ein Land negativer Schlagzeilen. Diktatur und so. Wie ihr Mann plauderte die schöne Gastgeberin entspannt über Weinanbaugebiete und Trüffelfunde nahe Turin, wo man eigentlich nur Fiat erwartet oder Juventus, vertiefte sich mit Antoinette in die Karriere des George Orwell, der vor Jahrzehnten ein Werk über die Kolonialzeit in Burma geschrieben hatte, welches sie meiner Geliebten dringend als Lektüre empfahl, da meine Prinzessin das nach einer demokratischen Atempause wieder von Generälen unterdrückte Land alsbald erkunden wollte.
Antoinette, das wurde mir später klar, machte viele Reisepläne, in etwa so wie ich als Junge, der am Hamburger Hafen das Ablegen der Frachter verfolgte und sich vorstellte, wie er eben mit diesem Schiff Jamaika erreichen würde, und mit dem anderen Dampfer New York und Kapstadt oder Sydney. Selbst Cuxhaven erweckte Fernweh in meiner Trümmer-vertrauten Seele. Später bin ich mit meiner Freundin häufiger verreist, aber eigentlich erreichten wir nie das Ziel, das wir uns gesetzt hatten. Wir schaukelten wie in einer Luftblase um die Welt; und Japan sind wir lediglich über Sushi-Restaurants näher gekommen.
Entschlackungswochen in Indien
Das Museum of Modern Art in New York City erwartete unsere Ankunft, die Chartergesellschaft in St. Barth war beglückt, weil sich eine echte Hoheit für ihre Jachten interessierte. Einige Entschlackungswochen in Indien waren vorprogrammiert, weil die Schönheit mit einem Maharadscha von Jaipur befreundet war. Eine Weltraumexpedition wurde angedacht, allerdings musste ihr Lieblingsonkel sie zunächst im Testament berücksichtigen. Immerhin sind wir mit ihrem „Topolino“, der nur ein wenig größer war als ein elektrischer Rollstuhl, von London nach Glyndebourne getuckert, da jenes Opernhaus nur in den Sommermonaten den Vorhang öffnet.
Feuchtigkeit legte sich auf das Cabriodach des italienischen Winzlings, das ich schließlich öffnen musste, nur weil Antoinette der Öffentlichkeit ihr neues Spielzeug zeigen wollte, ein Kindertelefon, rot und bereit zu tuten, wenn man auf die Gabel drückte. Das Telefon war mit nichts anderem verbunden als den Phantasien der königlichen Hoheit. Folglich entging sie den Abhöraktionen der NSA wie niemand anders auf der Welt. An jeder Ampel setzte sie den Hörer ans Ohr, redete laut auf Italienisch, antwortete auf Deutsch, wobei „Du Schweinehund“ ihr ganz besonders gefiel. Die Fahrer der Wagen, die neben uns hielten, bestaunten verwirrt das rote Telefon, in das eine amüsante Frau so ungeniert brüllte, als wollte sie Sizilien oder São Paolo ohne Hilfe der Leitungen, Unterwasserkabel und Satellitentechnik erreichen. Zuweilen blockierten die Rolls Royce oder Ford, die neben uns auf das Grün der Ampel warteten, die Umschaltphase, nur weil sie den Auftritt dieses temperamentvollen Weibes am Steuer erleben wollten. Gelegentlich klatschten sie Beifall. Wenn diese Gentlemen, natürlich waren’s nur Kerle, uns Pennies in den Wagen geworfen hätten, wäre ich ausgestiegen: Für mich war diese Albernheit genau das, albern. Für die königliche Volksschauspielerin war meine Reaktion nicht die eines „bloody German“, oder „hun“, was unter greisen Jahrgängen auf der Insel eine normale Reaktion gewesen wäre, sondern „kleinkariert“.
Der Kartenabreißer an der Oper war mir sogleich sympathisch, als er Antoinette mit Gleichmut erklärte, warum sie ihr doch so schönes Telefon nicht mit in die Oper nehmen dürfe. Anders als der Offizier, der meinen Namen ungeschminkt in den Schlosssaal geschmettert hatte, war der Kartenabreißer, der keine Orden aber ein Hörgerät, linkes Ohr, trug, wahrscheinlich überzeugt, ich sei der Pfleger der Dame. In gewisser Hinsicht stimmte das sogar.
Der Bulle reagierte nur auf Melonen
Glyndebourne gefiel mir, weil es dort relativ unkonventionell zuging. Die Veranstaltungen begannen am Nachmittag, meist Mozart, und noch bevor die Sonne sich fortstahl, wurde eine große Pause eingeklingelt, die Bayreuth als Provinzbühne erschienen ließ. Das verwöhnte Volk eilte zu den in Rolls Royce, Jaguar oder Bentley verstauten Fresskörben. Die Butler warfen karierte Decken auf die Kuhweiden, die die Oper umringten, Champagner-Korken knallten, Hummer-Sandwiches wurden gereicht und gelegentlich näherten sich Kühe. Verständlich, wann werden sie je mit wirklich vorzüglichem Krabben- oder Hummersalat gefüttert?
Antoinette hatte auf ihr Telefon nicht verzichtet, natürlich, aß Kirschen und warf die Kerne auf die Schnauze eines in der Nähe grasenden Bullen.
Er reagierte nicht.
Die Prinzessin hatte, passend zum roten Telefon, einen roten Mantel dabei, eine Kreation von Oscar de la Renta, den sie nun vor dem trägen Stier hin und her wedelte. Vergebens versuchte ich, sie zu stoppen, indem ich ihr mitteilte, dass spanische Toreros mir verraten hätten, dass nicht die Farbe Rot die Tiere provoziert, sondern die Bewegung des Tuches.
„Und warum“, fragte sie irritiert zurück, „stehe ich wie eine Verrückte auf der Weide und schwenke meinen Mantel? Wegen der Fliegen?“
Ein Gentleman von der karierten Kaschmir-Decke nebenan trat in die von Antoinette nicht verschossenen Kirschkerne und offerierte der königlichen Hoheit ein Glas Champagner. Klar war für mich, dass er damit die Stierprovokation unterbinden wollte. Mir reichte er kein Glas. Da ich lediglich 1,78 Meter groß bin, hatte er mich wahrscheinlich übersehen.
Antoinette war ein enfant terrible. Sie schreckte nicht davor zurück, ihrem Cousin, dem künftigen König, bei privaten Abendessen in ihrem Haus am Holland Park Nasi Goreng zu servieren, und dazu einen Wein zu reichen, der in der Qualität dem „Cröver Nacktarsch“ entsprach. Ich versuchte, obwohl ich nicht eingeladen war, sie von diesem Speise- wie Getränkeangebot abzubringen, aber ihr Argument war so einfach wie das Gericht, das sie von ihrer philipinischen Köchin zubereiten ließ: „Was er bei mir zu essen bekommt, bietet ihm sonst niemand“. Eine glasklare Logik, zumal der König im Wartestand sich häufiger am Holland Park anmeldete.
Antoinette lebte weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern jetzt, heute. Sie reagierte spontan, oft unüberlegt, man konnte ihr nicht vorwerfen zu zögern. Irgendwann ist sie sogar auf den Hund gekommen, bei der Einweihung eines Tierheims im East End von London.
Charlotte endete im Hochofen
Antoinette hatte einen Golden Retriever entdeckt, der müde erschien und seinen Schwanz nur einige Male bewegte, wahrscheinlich um zu dokumentieren, dass er noch nicht gestorben war. Die königliche Hoheit, der Ehrengast, tätschelte das ursprünglich für die Jagd gezüchtete Tier, das plötzlich Reaktionen zeigte. Es biss kräftig, ich ahnte instinktiv, dass es ein Weibchen war, in die neuen Schuhe der Prinzessin, die sie am Vortag bei „Harrod’s“ erworben hatte, made in Italy und 400 Pfund teuer. Hündische Eifersucht, das war’s. Oder die Botschaft, dass sie sich von keiner Frau unterdrücken lässt, gleich wie schön oder berühmt. Wir fuhren zu dritt im Topolino zum Holland Park zurück, Antoinette, „Charlotte“ und ich.
Wir wurden Freunde. Instinktiv wussten wir, dem Geruch nach, natürlich, dem Geruch der Straße und der Armut, dass wir Stammesgenossen waren, Straßenkind und Straßenköter. Unsere Harmonie überdauerte einen Sommer. Charlotte ermattete zunehmend, wahrscheinlich hatte ich ihr schwaches Herz zum Infarkt getrieben, mit all den weißen „Slazenger“-Tennisbällen. Sie hatte keine Lust mehr, idiotisch hinter denen herzurennen, die sie nicht fressen konnte, die nach Gummi rochen und nicht nach Urin. Sie verweigerte sogar Filetspitzen oder Nestlés Edelhundespezial. Eines Tages verzichtete sie auf Wasser und schloss die braunen Augen. Erstmals zeigte die Prinzessin Trauer. Sie weinte, wie ein Schlosshund.
Wir wollten Charlotte nicht unter einer Trauerweide vergraben, nein, wir würden sie einäschern lassen. Juristisch, gesetzlich, verwaltungstechnisch war das ein Unding. Der Tierarzt freilich kannte nahe der Tottenham Court Road einen Altmetallhändler, der einen Mini-Hochofen betrieb. Die Urne, mit der Antoinette und ich an einem herbstlichen Sonntagmorgen über den See im Hyde Park ruderten, war so groß wie eine Zuckerdose – ob das wirklich Charlottes Asche war? Oder die eines Gänseknochens? Weiß man das bei der Asche der Menschen? Uns war’s gleich. Über dem Wasser würde fortan eine hündische Seele schweben.
Bei unseren Ausfahrten konnten wir ihr Bellen hören, welches das Gezwitscher der Vögel übertönt. Wir ruderten oft auf diesem See, von dem aus wir die Royal Horse Guards bei ihrem morgendlichen Ausritt beobachten konnten, gemächlich oder im Galopp, stets würdig, königlich.
Charlottes Asche versackte wie Kaffeesatz. Antoinette warf eine Rose ins Wasser, die einsam dahintaumelte und dann absackte. Ich ruderte weiter. Am Bootssteg warteten keine Paparazzi.
Where is your captain?
Ihre Augen waren nahezu mandelförmig geschnitten, die Haare auch ohne Farbspülung pechschwarz, die Nase sinnlich geformt, trotz der fragilen Schärfe inmitten ihres ovalen Gesichts. Ihre Zähne müssten Zahncreme-Werber um den von Pfefferminz gestreichelten Atem bringen, waagerecht, wie mit einem Computer liniert. Welch Wunder, dass Ehefrauen saudischer Prinzen und Katar-Scheichs nach nur einem unschuldigen Lächeln der Golf-Schönheit ihren Zahnarzt suchen ließen. Selbst der Hinweis der Ermittler, dieser sei jüdischen Glaubens und habe bereits an der Klagemauer gestanden, also arabischen Boden und den Propheten entweiht, störte sie nicht: Ihre Männer beharrten darauf, mit den längsten und teuersten Yachten der Welt zu protzen, also sei ihr Wunsch nicht übertrieben, mit den schönsten Zähnen der Welt in eine Taubenpastete oder Hammelkeule zu beißen.
Meine schöne Freundin, nennen wir sie Ibtissam, war ein Geschöpf der Wüste, unter der Öl sprudelte und Gas. Die globalen Konten ihrer Familie, unabhängig von unberechenbaren Weltmarktpreisen, sind entsprechend gefüllt. Ibtissam, die Lächelnde, war für den Notfall, einem Umsturz etwa, mit einem britischen Pass abgesichert, erhielt allerdings, allein wegen ihrer Schweizer Konten, auch den Pass der Eidgenossen. Ihr Vater, Bruder des Herrschers eines am Golf gelegenen Scheichtums, muss zwar den unangenehmen Ölpreisverfall verkraften, aber wie mir Ibtissam anvertraute, kommt der Onkel mit einer täglichen Dollarmillion klar. Seine Tochter lässt der Papa in dieser Krise gleichwohl nicht darben. Die Quelle wird sprudeln bis in die Unendlichkeit, so Allah will, und aufs Sparen wird sich der Scheich erst besinnen, wenn die Erde rülpst und furzt und außer heißer Luft nichts mehr aufsteigt.
Für Ibtissams wirtschaftliches Wohlergehen ist vorgesorgt: Sie besitzt seit ihrem 18. Geburtstag ein Sparschwein der nicht alltäglichen Art, entworfen von der Londoner Luxusschmiede „Asprey“; überlebensgroß, massives Gold, der Kringelschwanz und die kleinen Augen mit Diamanten besetzt, per Kurier aus Antwerpen angelieferte Edelsteine. Ja, ein Schwein, das im Index des Korans ein teuflisches, ungenießbares Geschöpf ist. Aber, wie sagt ein deutsches Sprichwort? „Geld stinkt nicht.“ Das Schwein lagert übrigens in einem begehbaren Safe in einer italienischen Bank in Lugano.
Wir haben uns in Beirut kennengelernt. Die libanesische Hauptstadt wurde damals als das „Paris des Nahen Ostens“ gefeiert und in Reise- wie Modemagazinen verherrlicht: elegant, verführerisch, sexy, chic. Ich habe an der „American University“ Professoren und in den Flüchtlingslagern der Palästinenser Führer der Widerstandsgruppen über den ewigen Konflikt befragt, George Habash etwa. Der Linke war überzeugt, die Befreiung Palästinas müsse zeitgleich mit dem Sturz der arabischen Monarchien erreicht werden. Er war, welch Wunder, nicht eben beliebt bei den Saudis und Kuweitis oder beim, mir persönlich bekannten, Emir von Katar, der nach einem Familienputsch seine Rente in London verprassen konnte. Ich traf Ibtissam in der Uni-Cafeteria. Die reizvolle Araberin ließ ihre Wut an einem Cola-Automaten aus, der weder ihr Getränk noch das Kleingeld herausgeben wollte. Sie beschädigte dabei ihre italienischen Maßschuhe. Ihre Zerstörungswut war eine günstige Gelegenheit für mich, ihr Herz zu gewinnen, zumindest ihre Aufmerksamkeit. Ich zwang, obgleich handwerklich begrenzt fähig, die Münzen aus dem Automaten. Ibtissam ließ ihre Zähne blitzen, an sich schon eine Form von Edelsteinen, und diese Schönheit entfernte mich vorübergehend von Analysen über böse, bärtige, radikale Rebellen.
Wir tanzten, Ibtissam, die ewig widerspenstige Verführerin, und ich, in der „Cave du roi“, einer Disco, in der auch Lufthansa-Stewardessen mit ihren Piloten auf Tuchfühlung gingen, weil es im Cockpit nun wirklich zu eng war. Die Crew war im „Excelsior“ einquartiert, so wie ich, zwei Etagen über der Disco. Ein strategisch perfekt gelegenes Zimmer. Wir trafen uns zum Tee im edlen Hotel „Saint Georges“, mit Blick auf das Mittelmeer und die Berge, die der Schnee sahnespitzchengleich dekorierte.
Ich habe kein Foto aus dieser romantischen Zeit. Lediglich ein mit dem dunkelblauen Hotelschriftzug bedrucktes Badetuch, in das sich Ibtissam einrollte, sobald sie nach dem Bad im Mittelmeer ihren Bikini auszog. Erfolglos bot ich an, ihr den Rücken zu trocknen.
Eines Tages, das edle Hotel war inzwischen unter Bomben zerfallen, stand die Schönheit plötzlich wieder vor mir, wie ein pittoresker Geist der Vergangenheit – Place Dauphine, Paris, meinem damaligen Wohnort.
Kasino, Erbschaft oder Banküberfall?
Ihre Suite im ausverkauften Plaza Athenée, erklärte mir die eben in die Seine-Metropole angereiste Ibtissam am Telefon, sei wegen einer Fehlbuchung eine Nacht besetzt. Paris sei ausgebucht, wohl wegen einer Agrarmesse. Sie wäre dankbar für eine Unterbringung in meiner Gäste-Suite. Tatsächlich entsprach meine Wohnung der Größe des begehbaren Kleiderschrankes ihrer Familienvilla am Genfer See. Kein 400 Quadratmeter-Penthouse wie das ihres Vaters in Monte Carlo, Larvotto-Viertel. 60.000 Euro plus pro Quadratmeter. Freundschaftspreis. Ihre Schuhe hätten nicht in meine Küche gepasst, selbst bei Nutzung der Gefrierfächer in meinem Eisschrank und der Grillplatte im Gasofen. Ich wusste, dass sie stets mit ausgiebig Gepäck reiste. Ihre Familie hatte sich deshalb, auf unbegrenzte Zeit, 2.500 Dollar die Nacht, in einem Luxushotel auf Manhattan eine Suite zur Garderobe umfunktionieren lassen – für den Fall eines spontanen New York Besuchs.
Weil Ibtissam Bekleidung für zehn Tage in Paris eingeplant hatte, schleppte ich neun Louis Vuitton-Koffer über die schiefen Holztreppen des denkmalgeschützten Hauses, das in den 222 Jahren seit des Richtfestes nie eine derartige Invasion verkraften musste. Die noblen Gepäckstücke füllten mein Wohnzimmer und bedeckten meine eingetopfte Palme wie ein Pharaonengrab.
Ich hatte eben in Ibtissams nahezu schwarze, melancholische Augen geblickt, wahrscheinlich um mich physisch und psychisch wieder aufzurichten, als Polizeisirenen ertönten, begleitet von einem unromantischen Hupkonzert. Meine Besucherin hatte ihr Auto mitten auf der Straße vor der Tür stehen lassen, einer Einbahnstraße. Sie reichte mir den Schlüssel für ihr Fahrzeug und ich eilte vor die Tür, wo zwei Polizisten bereits notierten, was sie zu notieren hatten. Wahrscheinlich schrieben sie zu zweit, um sich bei der Fahrzeugnummer nicht zu vertun. Ich konnte nachvollziehen, warum sie mich verächtlich anblickten und erklärten, der Abschleppwagen sei unterwegs, um das Verkehrshindernis aus dem Weg zu räumen. Der reine Neid, wirklich! Ibtissam fuhr einen gelblackierten Aston Martin Volante, ein Cabriolet mit V8-Motor, der in wenigen Sekunden auf 100 war, so wie sie selbst, wenn ihr widersprochen wurde. „Das Ding“, so Ibtissam, war ein Geschenk ihres Vaters zum „Valentine’s Day“, dem von US-Supermarkt- und Warenhausketten sowie singenden Glückwunschkarten-Herstellern erfundenen Tag der Liebenden. Weil Ibtissam solo war, hatte Papa die Gefühlslücke ausgefüllt. Der Tacho des Dingsda registrierte ich erst später, zeigte wenig mehr als 1.000 Kilometer, in etwa die Entfernung von Monaco nach Paris. Die Flics beharrten auf ein Strafmandat, obwohl ich das noble Gefährt bereits in der Tiefgarage unter dem Platz in Sicherheit gebracht hatte. Der mir bekannte Parkwächter, an mein maßvolles, hellblaues VW-Cabrio, Jahrgang 72 gewöhnt, reagierte ohne Enthusiasmus: „Für Kratzer an diesem Schlitten bin ich nicht verantwortlich.“ Dann überkam ihn jedoch eine zurückhaltende Neugier: „Kasino, Erbschaft oder Banküberfall?“ Der Franzose bewies Humor, im Gegensatz zur Mehrheit seiner Landsleute, die Witz gelegentlich mit Schadenfreude verwechseln.
Das Strafmandat irritierte Ibtissam natürlich nicht.Derartige Lapalien erledigte der Anwalt ihres Vaters. Der musste auch den Hautarzt honorieren, den Ibtissam morgens um vier im Hotel antreten ließ. Ein Pickel hatte sie irritiert, in der Größe eines Stecknadelkopfes. Es war wohl gegen zwei Uhr morgens, als ich mich damit abgefunden hatte, auf meinem ledernen, kalten Chesterfield-Sofa zu schlafen und ihr mein gänsedaunenumhülltes Bett zu überlassen. Ich war erschöpft, denn nicht täglich schleppte ich neun Koffer und ein Beauty Case, geräumig genug, um als Kofferersatz für eine Kreuzfahrt auf der „Queen Elizabeth II“ zu dienen.
Ein echter Freund würde Kaviar herbeizaubern
Mein allerliebster Gast freilich spürte keine Müdigkeit. Stattdessen reklamierte die schöne Araberin ihr Dinner, und sie war, natürlich, mit einem Yoghurt, der sein Verfallsdatum bereits überschritten hatte, nicht zu beruhigen.
„Ein echter Freund“, erklärte sie, offensichtlich ein Profi psychologischer Kriegsführung, „würde jetzt Kaviar herbeizaubern, irgendwo in dieser Stadt, die angeblich niemals schläft.“
Mir fiel das „Maison du Caviar“ unweit der Champs Elysées ein. Ich war aber sicher, dass der mir bekannte Mâitre mit seiner Geliebten, der dienstältesten Nackt-Tänzerin des „Crazy Horse Saloon“, 12. Saison, kein Lifting (behauptet er), seine Kaviarhalden längst in die Mega-Eisschränke geschoben hatte und nun im „Chien qui fume“ pokerte, einem Etablissement, in dem Kellner der Stadt ihre Trinkgelder verjubelten.
Ich ließ mich weder erpressen noch verwirren. Ich wusste seit früheren, abgewehrten Versuchen, dass Ibtissam mich aus Dank nicht einmal platonisch umarmen würde. Sie war eine religiöse Muslimin und wartete auf ihren Helden, der Mannes und reich genug war, ihr die Unschuld zu nehmen.
Ich wagte also, ihr statt Kaviar Spaghetti anzubieten: „Du kochst die Nudeln, ich mache uns eine tolle Tomatensauce.“
Nach diesem Vorschlag ließ sie sich auf das weiche Daunenbett fallen und ich stellte mich darauf ein, dass sie nun weinen würde, sozusagen als letzte oder vorletzte Waffe dieser Art von Frau. Ich entdeckte, dass ihre Fußnägel rosarot bemalt waren und einen wunderbaren Kontrast zu ihrer leicht matt gefärbten Haut darstellten. Überdies bemerkte ich zwei himmlisch schöne, enthaarte, gewachste Beine, die sich in der Tabuzone verloren. Mein Blick war rein zufälliger Natur. Ich schwöre es beim Barte des Propheten. Friede sei mit ihm.
Sie sei noch nie in den Küchen ihrer elterlichen Besitzungen gewesen, verriet mir meine Freundin, die dennoch keine Magersucht erkennen ließ. Auf meinen wirklich dummen Einwand, „dann hast du sicher noch nie in deinem Leben ungekochte Spaghetti gesehen“, blickte sie mich mitleidig mit ihren von der Weite der Wüste gezeichneten Augen an: „Nein, muss man das, um als intelligent zu gelten?“
Ich war bass erstaunt, denn in Beirut war die Studentin Ibtissam weltoffen, bereit über Literatur zu reden, zumal sie Kunstgeschichte studierte. Sie kannte sich sogar mit Mozart aus und wusste, dass der kein Mohamedaner war. Sie schätzte das „Posthorn“ und die Serenade Nr. 9, weil traditionelle arabische Musiker auf ähnlichen Hörnern blasen wie die Postkutschen-Fahrer seinerzeit. Selbst ihre Fähigkeit Spaghetti kochen zu können, hätte ich nie bezweifelt. Und nun das. Wir nudelten nicht, sondern stritten um die Härte eines Lebensmittels. Womöglich hatte sie in Paris ohnehin der Kulturschock getroffen. So manches stürzte in den ersten Stunden auf sie ein, nicht nur die Diskussion um Küchendienst und ungekochte Nudeln.
In ihrer Heimat wandeln Männer, ein Beispiel nur, in brüderlicher Gemeinsamkeit Hand in Hand durch die Medina-Gassen. Normalität. Männer im sanften oder satten Kuss vereint, wie am folgenden Morgen auf dem Pariser „Pont des Arts“, das war für sie wirklich zu vermessen. Sie zog am Ärmel meiner weißen Leinenjacke und wollte, zwischen Empörung und Verwirrung, wissen: „Was machen die denn da?“
„Die küssen sich. Zumindest sieht das aus der Entfernung so aus. Was sonst? Zahnärztliche Helfer bei der dentalen Hygiene?“
Unser Spaziergang, der uns auch durch das ehedem jüdische Viertel, dem Marais, führte, wo homosexueller Herdentrieb die einsamen Männer auf die Weiden ihrer Sehnsucht treibt, verstärkte fraglos ihre Zweifel an den Werten der westlichen Kultur. Orthodoxe Juden in schwerem, schwarzem Tuch, crepe- oder gummibesohlten Schuhen und überlangen Locken wanderten an den Schwulen vorbei. Die waren in Shorts gekleidet und hatten sich unübersehbar allesamt auf militärkurze Frisuren, ärmellose T-Shirts und klobige Schnürstiefel in beige, Marke „Timberland“, geeinigt.
Schleier weg, runter mit dem Tuch
Die Juden nickten und schwiegen, die Schwulen warfen den Langgelockten Handküsschen nach. Ibtissam war keine politische Eiferin, weder antisemitisch noch antiisraelisch eingestellt. Die öffentlichen Diskussionen über verhüllte muslimische Frauen nervten sie allerdings. „Warum wird eine Frau in eine Terroristenecke gestellt, weil sie aus religiöser Überzeugung am Strand oder im Shoppingcenter weder ihren Körper noch ihr Gesicht zeigen will?“, wollte sie im „Café Costes“ von mir wissen, und nahm versehentlich einen Schluck aus meinem Gin Tonic-Glas.
„In deinem Fall, bei solchen Beinen, wäre das Hochverrat“, erwiderte ich.
„Eine wirklich dämliche Bemerkung“, meinte sie und trank Perrier aus der Flasche, vermutlich um meinen Gin aus ihrem System zu spülen.
„Ja, Männergeschwätz“, räumte ich ein.
„Schleier weg! Runter mit dem Tuch! Das nennst Du Toleranz? Religionsfreiheit?“
Jawohl, da waren wir wieder im Nahostkonflikt. Verfangen in Emotionen. Bitte, bitte, nicht jetzt diese Debatte um Kopftücher oder Gesichtsschleier, nicht heute, später vielleicht, wenn alle Frauen der Welt den Musliminen nacheifern und Gesichtsmasken tragen, damit das Virus sie nicht beißt.
Ibtissams Parfum, ihre wallenden Mandelaugen, verwirrten und führten mich, immer wieder, an die Grenzen des Irrationalen, obwohl mir verführerische Schönheiten aus dem Morgenland über Jahre hinweg vertraut waren. Bei meinen ersten Flügen von Beirut nach Paris oder London fiel mir auf, dass sich die einheimischen Geschöpfe vor den Toiletten aufreihten, zwei Dutzend hintereinander, allesamt im keuschen Dschellabah, einer Mischung aus Kleid und Überhang. Wenige im Vollschleier. Ich konnte mir nicht erklären, warum der plötzliche Aufstieg auf 10.000, 12.000 Meter Flughöhe dem Augenschein nach dramatische Wirkungen auf das Verdauungssystem der weiblichen, arabischen Fluggäste hatte. War’s das gefilterte Wasser, die klimatisierte Luft? Nein, Dior, Balmain, Fath, Saint Laurent, später Gucci, Hermès, Versace, Chanel, Armani, Ralph Lauren, Lagerfeld. Die Ladies verließen die fliegenden Umkleidekabinen, als seien sie durch eine Zeitkapsel geschritten. Jäh war die Keuschheit, Gedanken an Nikab, Khimar, Burka, Vollschleier, Halbschleier, Sehschlitze oder ohne, Blickkontakt ja oder nein, Burkina oder Bikini, Versuchung oder Verführung, verdrängt: Körperbetonte Seidenkleider, hohe Absätze, mit denen sich die ersten Schritte nach den Sandalen als wackelig erwiesen, was bei den Bewegungen eines Flugzeuges nicht unbedingt auffiel.