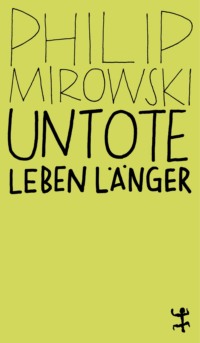Kitabı oxu: «Untote leben länger»
Philip Mirowski
Untote leben länger
Philip Mirowski
UNTOTE LEBEN LÄNGER
Warum der Neoliberalismus nach der Krise noch stärker ist
Aus dem amerikanischen Englisch von Felix Kurz
 Matthes & Seitz Berlin
Matthes & Seitz Berlin
Den Neoliberalen in allen Parteien
Inhalt
1
Alptraum auf Alptraum
Die Krise, die kaum etwas änderte
Zweitklassige Horrorfilme folgen häufig einer klassischen Dramaturgie: Der Protagonist blickt dem Untergang ins Auge, erwacht auf dem Höhepunkt der Katastrophe jedoch plötzlich in einer anderen Welt, die zunächst normal scheint, sich aber schließlich als ein zweiter, noch entsetzlicherer Alptraum entpuppt.1 Seit dem Ausbruch der Wirtschaftskrise im Jahr 2007 ist in der Realität etwas ganz Ähnliches geschehen. Zunächst wurde man entsetzt Zeuge, wie infolge des Crashs die Immobilienpreise abstürzten, die verbliebene Industriebeschäftigung einbrach, sich ganze Stadtviertel in ausgebombte Ruinen verwandelten und Renten und Ersparnisse in Luft auflösten; die Hoffnung auf ein besseres Leben für unsere Kinder schwand dahin, Nachbarn deckten sich mit Schusswaffen ein, und mancher meinte, anstatt des Bankrotts nahe das Jüngste Gericht. Es war ein verstörendes Intermezzo, in dem die Statistiken über die Große Depression in den Dreißigern an Nietzsches Wiederkehr des Immergleichen denken ließen.
Spulen wir vor ins Jahr 2011. Ob zu Recht oder Unrecht, es regte sich gerade die Hoffnung auf den Beginn eines Umschwungs. In den großen Zeitungen hieß es, die Wirtschaftswissenschaft habe versagt und unsere klügsten Köpfe würden die Lehrmeinungen, die die Welt auf Abwege geführt hatten, gründlich überdenken. Doch gegen Jahresende dämmerte den meisten, dass die naheliegende Annahme, wir könnten uns aus dem Alptraum befreien und aus den Fehlern der Ära des neoliberalen Irrwitzes lernen, nur einer weiteren tückischen Sinnestäuschung geschuldet war. Ein dunkler Schlummer legte sich über das Land. Nicht nur dass sich das Bewusstsein der Krise wieder verflüchtigt hatte, ohne dass es irgendeinen ernsthaften Versuch zur Korrektur der Fehler gegeben hätte, die die Wirtschaft beinahe zum Stillstand gebracht hatten – seltsamerweise war die Rechte aus den Tumulten obendrein stärker, unverfrorener und mit einer noch größeren Raffgier und Glaubensfestigkeit als vor dem Crash hervorgegangen.
Im Jahr 2010 brach für die Linke eine traurige Ära der Verwirrung und Ratlosigkeit an. Es bedurfte außergewöhnlichen Stehvermögens, um angesichts des rasanten Wiederaufschwungs der Rechten unmittelbar nach der dramatischsten Weltwirtschaftskrise seit der Großen Depression nicht fassungslos nach Luft zu schnappen. »Missverhältnis« ist ein zu höflicher, »Widerspruch« ein zu altmodischer Begriff für den Gang der Ereignisse. In beinahe allen Ländern wurde Austerität die Losung der Stunde, und bei Unmut jeder Art – auch über die Austerität – wurde überall die Regierung verantwortlich gemacht. Im Namen der wirtschaftlichen Vernunft geriet die Arbeiterklasse von allen Seiten unter Beschuss, selbst von nominell »sozialistischen« Parteien, und die wenigen Versuche einer gewerkschaftlichen Gegenmobilisierung scheiterten. Linke Parteien, die sich noch wenige Jahre zuvor nach Dekaden eines neoliberalen Vormarschs endlich wieder im Aufwind wähnten, waren ratlos angesichts einer von Europa bis nach Nordamerika und Asien reichenden Dominanz neoliberalen Denkens und konservativer Parteien. Häufig wurden sie kurzerhand ungerührt abgewählt, weil sie mit Mühe versucht hatten, die schlimmsten Krisenfolgen einzudämmen. Den Finanzinstituten, die die Krise ausgelöst hatten und vom Staat gerettet worden waren, ging es dagegen gut, ja sie florierten wie vor der Krise, und mit offener Undankbarkeit finanzierten sie die wiedererstarkende Rechte – die beachtliche Erholung der Unternehmensgewinne bot die Gewähr dafür, dass konservative Denkfabriken nach der Krise eine aufwendige Verjüngungskur erhielten. Nationalistischprotofaschistische Bewegungen sprossen an Orten, wo man es nie vermutet hätte, aus dem Boden und vertraten Positionen, die keinen Funken Verstand mehr enthielten. Das Ganze ließ sich ohne Übertreibung als »Alptraum« bezeichnen; eitle Hoffnungen platzten.
Der Winter unseres Stussvergnügens
Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal mit Schaudern realisierte, dass der geistige Dämmerzustand nach der Krise noch weit schlimmer werden könnte als während der Rezession selbst. Im April 2011 nahm ich am zweiten Treffen des Institute for New Economic Thinking (INET) in Bretton Woods, New Hampshire, teil.2 Es hätte vermutlich bessere Orte als die White Mountains gegeben, um den Zeitgeist nach der Krise einer Fiebermessung zu unterziehen und die politische Ökonomie in der Praxis zu beobachten, doch die kleinen Sünden der Wirtschaftswissenschaftler hatten mich schon lange fasziniert, und das erste INET-Treffen, 2010 an der Cambridge University abgehalten, schien mir ein gewisses Versprechen zu bergen – zum Beispiel als Protestierende in der Aula des King’s College die IWF-Platitüden von Dominique Strauss-Kahn unterbrachen oder als Lord Adair Turner mutig erklärte, wir bräuchten einen deutlich kleineren Finanzsektor. Doch die Folgeveranstaltung fiel nicht nur aus klimatischen Gründen wesentlich unerfreulicher und frostiger aus. Das alptraumhafte Szenario begann mit einer Parade von Figuren, die niemand guten Gewissens als Vertreter eines »neuen ökonomischen Denkens« bezeichnen könnte: Kenneth Rogoff, Larry Summers, Barry Eichengreen, Niall Ferguson und Gordon Brown. Adair Turner wurde wie im Vorjahr für eine Rede auf die Bühne zitiert, wartete aber nur mit trüben Gemeinplätzen über »Glücksstudien« und Rationalität auf. Das Spektrum ökonomischer Positionen hatte sich deutlich verengt, und das Programm richtete sich offensichtlich vor allem an Journalisten, Blogger und Leute, die sich für komplexe, unkonventionelle Gedanken gar nicht interessierten, sondern Stars aus der Nähe sehen wollten – es zeugte von dem ungesunden Drang nach einem Denken, das um jeden Preis mit offiziösem Gütesiegel beglaubigt sein und nach etwas klingen sollte.
Viele Teilnehmer gaben ihre Ratlosigkeit offen zu: Die Krise war vorbei, nur was war eigentlich schiefgelaufen? Dass die in westlichen Ländern beschlossenen »Rettungspakete« ein politisches Debakel darstellten, erkannten alle an, wobei nähere Ausführungen darüber sicherlich weniger Konsens gefunden hätten. Manche meinten, der akute Handlungsdruck auf Seiten der Federal Reserve, des britischen Schatzamtes, der Europäischen Zentralbank und anderer Institutionen habe eine notwendige Phase der Reflexion und Reform blockiert. Was die Veranstaltung jedoch zu einem Alptraum machte, war eine ansteckende Lähmung, die an ein Reh im Scheinwerferlicht erinnerte: Die Konferenzteilnehmer gefielen sich zwar in der Rolle von Kritikern der neoliberalen Dekadenz, hatten jenseits vorgetäuschten Expertenwissens aber keine festen Ansichten darüber, worin das für die Krise verantwortliche intellektuelle Versagen überhaupt bestand – offenbar verband sie bloß ein vages Unbehagen am Zustand der Wirtschaftswissenschaft. Doch es kam noch schlimmer: Während die Autoritäten schwankten, hatten sich die Darsteller aus dem Gruselkabinett der Rechten wieder aufgerichtet, den Staub von den Kleidern geklopft und zu neuer Stärke gefunden. Ökonomen wie Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart besaßen auf dem INET-Treffen die Unverfrorenheit, die jüngste Weltwirtschaftskrise als ganz normalen Konjunkturzyklus darzustellen: Von Skandalösem oder Beispiellosem könne keine Rede sein. So begannen die im American Enterprise Institute und Cato Institute ausgebrüteten Doktrinen wieder in den Bereich des Respektablen einzusickern. Die Konferenzteilnehmer versuchten sich unterdessen weiter zu lösen – nur von was? Von der neoklassischen Mikroökonomie, von der Theorie der rationalen Erwartungen, von der Effizienzmarkthypothese, von dem Coase-Theorem, von pseudokeynesianischer Makroökonomie, von dem Pareto-Optimum, von der Public-Choice-Theorie, vom Ende der Geschichte – also wovon jetzt genau? Wie sollte man wissen, ob etwas faul war oder nicht, wenn man nicht einmal sicher war, welche Theorie einem Orientierung bieten könnte?
Der Leser mag einwenden, ich hätte mir diesen Alptraum selbst eingehandelt, denn wie sollte auch ein von George Soros ausgerichteter und finanzierter Rummel ein wirklich »Neues Ökonomisches Denken« hervorbringen?3 Wie zu erwarten, gab es in Bretton Woods kaum eine ernsthafte Debatte, ja nicht einmal einen flüchtigen Überblick über mögliche Alternativen in der Wirtschaftswissenschaft; stattdessen herrschte eine so drückende Nostalgie, dass die üppigen Desserts ranzig wurden. Eine bunte Riege von B-Promis – nach John Maynard Keynes sollte kein Ökonom je wieder die Bekanntheit eines Arnold Schwarzenegger, Bob Dylan oder auch nur Malcolm Gladwell erlangen – hoffte auf den erregenden Schauder einer gefahrlosen Grenzüberschreitung: Ihr Drang zur Dissidenz wurde durch die nüchterne Einsicht gezügelt, dass konkrete Abweichungen von der wirtschaftswissenschaftlichen Orthodoxie, der sie schließlich ihren bescheidenen Ruhm zu verdanken hatten, eher ungeschickt wären. An dem Dogma, dass in den letzten 75 Jahren schlechterdings nichts geschehen sei, was den Debattenraum über die vermeintlich durch Keynes und Hayek markierten Grenzlinien hinaus verschoben habe, zeigte niemand auch nur das leiseste Unbehagen. Viele Redner genossen es sichtlich, in den heiligen Hallen von Bretton Woods den Geist Keynes’ heraufzubeschwören. Meine Hoffnung, das INET könnte alternativen Strömungen der Wirtschaftswissenschaft ein Forum bieten, war eindeutig albern gewesen, denn wären dort Postkeynesianer, Regulationstheoretiker, Institutionalisten, Anhänger Hyman Minskys oder gar Marxisten chinesischer Couleur aufgetreten, dann hätte die intellektuelle Schickeria die Konferenz gemieden wie die Pest.4 Doch das alptraumhafte Szenario beschränkte sich nicht auf das INET oder George Soros. Es erwies sich als viel umfassender.
Von den White Mountains nach Mont Pèlerin
Vom 5. bis 7. März 2009 hielt die Mont Pèlerin Society (MPS) in New York, dem Ground Zero der Weltwirtschaftskrise, ein Sondertreffen ab, um die Folgen der Erschütterungen für ihr politisches Projekt zu diskutieren. Rund hundert Mitglieder und ebenso viele Gäste versammelten sich unter dem Titel: »Das Ende des globalisierenden Kapitalismus? Klassisch liberale Antworten auf die globale Finanzkrise«. Zu dieser Zeit fürchteten viele Köpfe der neoliberalen Bewegung, die Krisenlawine könne sich für sie selbst zu einem furchtbaren Alptraum entwickeln. Schließlich war das entscheidende Ereignis, das ursprünglich zu dieser Organisation des Neoliberalen Denkkollektivs (NDK) geführt hatte, die Große Depression der Dreißigerjahre gewesen. Die anfangs bunt zusammengewürfelte Gruppe um Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Lionel Robbins und Milton Friedman musste damals die schmerzhafte Erfahrung machen, für ihre Antwort auf die schwere Krise verspottet, attackiert und an den Rand des Diskurses abgedrängt zu werden, denn »der wirtschaftliche Motor des Fortschritts«, der Markt, wollte partout nicht anspringen. 1947 versammelten sie sich am Mont Pèlerin, um über Wege zu ihrer intellektuellen Rehabilitierung zu beratschlagen. In vieler Hinsicht war die erste Generation der Neoliberalen den Rest ihres Lebens mit der Bewältigung der Schmach beschäftigt, dass Keynes, Franklin D. Roosevelt, Wissenschaftler wie J. D. Bernal, eine Phalanx von Marktsozialisten wie Oskar Lange und Jacob Marschak sowie etliche europäische politische Denker über sie triumphiert und sie ausgegrenzt hatten. Angesichts dessen war es im Jahr 2009 kein abwegiger Gedanke, dass die Neoliberalen der dritten Generation in mächtige Schwierigkeiten geraten könnten.
Früher einmal hätte das neoliberale Exekutivkomitee in einer solchen Notsitzung versucht, durch kreative Denkansätze die bestmögliche Antwort auf den drohenden Zusammenbruch seiner Weltanschauung zu finden. In einer Reprise der Vierzigerjahre hätten die Neoliberalen des Jahres 2009 zum Beispiel neue Denkmodelle über den Markt entwickeln können – eine Verbindung ursprünglich etatistischer Konzepte mit einer Neudefinition der »wahren Natur« von Marktbeteiligung hätte auch der Linken Wind aus den Segeln genommen. Für den Historiker ist es verblüffend, wie häufig die Neoliberalen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Ideen der Linken zweckentfremdet haben. Geht man jedoch die Beiträge zur New Yorker Konferenz durch, dann findet man vor allem vorhersehbare Plattitüden und fade Neuauflagen der Behauptung, die bösartige Regierung habe die Krise verursacht.5
Deepak Lal stellte in seiner Ansprache die interessante Frage, wie es zur Krise kommen konnte, wo doch so viele »Freunde der MPS« wie Alan Greenspan und Jean-Claude Trichet für das Weltfinanzsystem verantwortlich gewesen seien, und deutete an, möglicherweise hätten sie sich nicht ausreichend um »solides Geld« gekümmert. Niall Ferguson hob die Moral der Truppe mit dem Katechismus, die staatliche Regulierung – nicht etwa ein Versagen der Marktwirtschaft – müsse die Krise verursacht haben, und ging zudem seinem persönlichen Lieblingsthema einer möglichen Schuld Chinas nach. Gary Becker erklärte, anstatt in Reaktion auf die Krise mit allerlei staatlichen Heilmitteln herumzuhantieren, sollte man besser gar nichts tun. (Das vorliegende Buch zeigt, dass dies in Wirklichkeit gar nicht die Position der Neoliberalen ist.) Insgesamt herrschte auf der Konferenz die Stimmung vor, dass Neoliberale – wobei die eigentlich bemühte Bezeichnung »klassisch liberal« als eine in späteren Kapiteln zu erörternde Nebelkerze diente – trotz der etwas beängstigenden Krise im Grunde weitermachen sollten wie gehabt.
Nach der Blütezeit der MPS im Anschluss an den Krieg sahen manche Linke in all dem nun mitunter einen Beleg für ihren Niedergang; vielleicht waren die Konferenzteilnehmer, wie die meisten Ökonomen, aber auch einfach von den Ereignissen überrascht worden. Doch so oder so scheint es heute, dass die Neoliberalen unbeschadet durch die Krise gekommen sind. Sie hat dem NDK keineswegs wie in den Dreißigerjahren einen Ruck zur Erneuerung gegeben, sondern es in seiner Unnachgiebigkeit, Redundanz und Einfallslosigkeit noch bestärkt. Wie heute deutlich wird, lagen die Neoliberalen mit ihrer Beharrlichkeit durchaus richtig, denn entgegen allen Erwartungen hat die Krise kaum etwas verändert. Allerdings haben sie nicht kampflos gewonnen – das wäre eine armselige Interpretation der Ereignisse. Neoliberale lassen eine ernsthafte Krise nicht ungenutzt verstreichen: Um ihren Triumph sicherzustellen, haben sie bestimmte Schachzüge unternommen. Dieses Buch soll die Strategien der Neoliberalen dokumentieren und ihre Erfolge begutachten, zu denen häufig auch die Wirtschaftswissenschaftler beigetragen haben.
Dass die Ökonomen von den White Mountains bis nach Mont Pèlerin nur abgegriffene Antworten auf die Krise parat hatten, ist inzwischen gängige Meinung. Allerdings fällt die Bilanz für die zwei großen politischen Lager geradezu gegensätzlich aus: Während die Rechte die Krise mit monotonen Wiederholungen erstaunlich gut überstanden hat, büßte die bereits vor der Krise in schlechter Verfassung befindliche Linke durch sie noch weiter an Boden ein. Jenseits von Ausreden bleibt die Frage, inwieweit das unerwartete Erstarken der Rechten nach der Krise auf dem neoliberalen kulturellen Gefüge beruht, das in der Phase von 1980 bis 2008 aufgebaut wurde, und umgekehrt, inwieweit die Linke ihre Niederlage selbst herbeigeführt hat. Diese Frage verdient meines Erachtens eine gründlichere Untersuchung.
An der Struktur des globalen Finanzsystems hat sich seit der Krise nichts substanziell geändert.6 Die politischen »Reformen« sind in Europa wie in den Vereinigten Staaten bestenfalls oberflächlich ausgefallen. Auch nach 2008 zeigten etwa der »Flash Crash« im Mai 2010, bei dem die Kurse an der Wallstreet innerhalb von Minuten extrem einbrachen, das Debakel des Börsengangs des US-Handelsplatzes BATS im März 2012 und die durch einen Softwarefehler ausgelöste Kernschmelze des Finanzdienstleisters Knight Capital im August 2012, dass die Fehlfunktionen des Marktes viel gravierender sind, als die übliche Fixierung auf Hypothekenverbriefungen und betrügerische Bankgeschäfte nahelegt, doch eine konzertierte Reaktion darauf blieb aus. Zum ersten Mal seit dreißig Jahren treten stagnierende Beschäftigung und anhaltende Inflation wieder gleichzeitig auf, auch wenn die zuständigen Behörden dies beharrlich zu vertuschen suchen. Bei der Spekulation mit Rohstoffen (besonders Öl) und bei Börsengängen (wie dem von LinkedIn und des Informatikkonzerns Fusion-io) haben sich erstaunlich schnell wieder Blasen gebildet. Der weitreichende Konsens, staatliche Ausgabenkürzungen seien die beste Medizin gegen die Krise, zeigt unterdessen, dass die öffentliche Debatte auf das analytische Niveau der frühen Dreißigerjahre herabgesunken ist. Die MPS ist einer schmachvollen Widerlegung ihrer wirtschaftspolitischen Vorstellungen offenbar entgangen – eine dramatische Niederlage haben vielmehr ihre Gegner auf der »moderaten« Linken erlebt. Da innovative neoliberale Analysen offenkundig fehlen, drängt sich der Verdacht auf, dass diese Schwäche der Linken nicht zuletzt in dem begründet liegt, was in der wirtschaftswissenschaftlichen Orthodoxie als staatsinterventionistische Lehre gilt. Aber die Ursachen könnten sogar noch tiefer reichen.
Wo Rauch ist, ist auch Toast
Es gibt eine Unmenge von Büchern und Artikeln über die Krise. Viele Leser, die 2009 und 2010 begierig zugriffen, fühlten sich nach der Lektüre jedoch weniger informiert als vorher, was schlimm genug ist. Hinzu kommt, dass man einen Alptraum nicht freiwillig ein zweites Mal durchlebt, sondern lieber wieder aufwacht. Zuletzt scheint solche Literatur deshalb nur noch Fans dramatischer Zusammenbruchsgeschichten angesprochen zu haben. Die große Mehrheit hatte sich dagegen schon 2012 aus ernsthaften Debatten ausgeschaltet und war vor dem Tsunami zu spät gekommener Weisheiten geflüchtet.
Eine kurze Zeit lang versuchten Karikaturisten und Fernsehkomiker, aus der ganzen Geschichte einen Witz zu machen. Darin klagten idiotische Banker, die sture Öffentlichkeit wolle einfach nicht verstehen, dass sie als Einzige den von ihnen angerichteten Saustall auch wieder ausmisten könnten, wobei sie sich ebenso mürrisch wie reuelos zeigten, als Uncle Sam ihnen genau zu diesem Zweck ganze Lkw-Ladungen Geld schickte. Wie so oft verblasste die Satire neben der Wirklichkeit, als Hank Greenberg, ehemals Chef des Versicherungsgiganten American International Group (AIG), die US-Regierung für mangelnde Großzügigkeit bei der Rettung seines Konzerns verklagte.7
Auch wenn bitterböser Humor urkomisch sein kann, ruft er in diesem Fall eine nagende Stimme auf den Plan: Sind Witze über die unsichtbare Hand nicht etwas billig? Ist Lachen wirklich die angemessene Reaktion auf den Alptraum der Krise? Haben sich deren Mitverursacher nicht vielleicht selbst (einiges) ausgeschüttet vor Lachen, während das Finanzsystem auf den Abgrund zusteuerte? Zumindest in den Sitzungen des Offenmarktausschusses der Federal Reserve herrschte offenbar große Heiterkeit, wie die grafische Darstellung der dort von 2001 bis 2006 protokollierten Lacher in Abbildung 1.1. zeigt. Der Appell an den Sinn für Humor, auf dass wir es sind, die zuletzt lachen, ist nicht unbedingt das beste Mittel gegen Krisenmüdigkeit.
Abb. 1.1: Heiterkeit in der Federal Reserve

Quelle: Federal Reserve FOMC Transcripts, Grafik: Daily Stag Hunt
Der Filmemacher Adam Curtis empörte sich: »Trotz der Desaster sind wir [noch immer] in der Welt der Ökonomen gefangen.«8 Wir müssen jedoch zwischen der Welt der Ökonomen und der der Neoliberalen differenzieren, die viele Linke fälschlicherweise gleichsetzen. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Neoliberalen an die von manchen Ökonomen verbreitete Bilderbuchversion des Laissez-faire-Prinzips zumeist gar nicht glauben. Auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit oder selbst im Grundkurs Wirtschaftswissenschaft zu ihr bekennen, spielt sie in anspruchsvolleren internen Diskussionen keine Rolle und wird von der politischen Praxis des Neoliberalismus klar missachtet.
Das neoliberale Plädoyer für wirtschaftliche Ungleichheit kann auch zu einem Plädoyer für Ungleichheit im Bereich des Wissens führen, wie wir in Kapitel 2 eingehend untersuchen werden. Leser von Michel Foucault sind mit dem Gedanken vertraut, dass der Neoliberalismus die Ontologie des Subjekts in der modernen Gesellschaft transformiert; übersehen wurde in dieser Traditionslinie dagegen, wie er spiegelbildlich dazu auch der Bedeutung der Existenz eines »Marktes« als solchem eine neue ontologische Bedeutung gibt.
Was an der Fülle nachträglicher Krisenerklärungen irritiert, hat Maureen Tkacik beschrieben:
»Dass an den letzten zehn Jahren etwas unhaltbar war, ließ sich leicht feststellen. Die Wahrheit jedoch – dass eine gesamte Ideologie unhaltbar geworden war – haben wir noch immer nicht begriffen. Und deshalb überbieten sich nun Journalisten, Ökonomen, Intellektuelle und Finanzmanager bei der Publikation von Büchern, die sich meist wie die Memoiren von Leuten lesen, die sich weniger dumm vorkommen wollen. Das heutige Finanzsystem wurde zu dem Zweck errichtet, dass wir uns alle dumm vorkommen, und im Zuge seiner Errichtung verdummten seine Architekten selbst.«9
Die Krise hat nicht nur eine massenhafte, weithin stumm erduldete Verarmung bewirkt, sondern auch unser Vertrauen in die eigene Fähigkeit zerstört, das System, in das wir heute eingezwungen sind, adäquat zu begreifen. Es gehört zum guten Ton, das groteske Schauspiel von Gruppierungen wie der Tea Party, der Goldenen Morgenröte, den Wahren Finnen und dem Front National aufs Schärfste zu kritisieren – aber kann die Linke wirklich behaupten, sie sei seit 2007 so viel nüchterner und intelligenter gewesen? Das Problem, dem ich mich in diesem Buch nähern will, lautet: Wie schaffen es diejenigen, die der unerwarteten Befestigung der neoliberalen Vorherrschaft mit Entsetzen ins Auge blicken, sich weniger dumm vorzukommen? Wie müsste eine erhellende Intellectual History der Krise und ihrer Folgen aussehen?
Wenn es um die Rolle des Nostradamus der Krise geht, hat offenbar jeder seinen Favoriten – das schwierige Thema der Prognostik werde ich in Kapitel 5 behandeln. Hier geht es mir zunächst um jene nominellen Linken, die sich schon vor langer Zeit von der marxistischen Eschatologie eines Zusammenbruchs des Kapitalismus, gefolgt vom Übergang zum Sozialismus, verabschiedet haben, nur um sich heute auf ein ungerührtes Bekenntnis zur Unwissenheit zurückzuziehen. Ein beliebiges Beispiel dafür aus den Reihen der Journalisten (zu den Ökonomen komme ich später) bietet Ezra Klein mit einer Besprechung des Krisen-Dokumentarfilms Inside Job:
»Inside Job ist vielleicht dort am stärksten, wo er detailliert die Interessenkonflikte unterschiedlicher Akteure mit Blick auf den Finanzsektor schildert, wobei es sich um ›Konflikte‹ gerade deshalb handelte, weil die Akteure auch gewichtige Gründe dafür hatten, ihre Sache gut zu machen – etwa Reputation, Geld, Zuspruch und Arbeitsplatzerhalt.
Gerade das macht die Finanzkrise letztlich so beängstigend. Die Komplexität des Systems überforderte Marktteilnehmer, Experten und Aufsichtsbehörden erheblich. Selbst nach dem Ausbruch der Krise waren die Geschehnisse teuflisch schwer zu begreifen. Manchen gelang es zwar, die richtigen Zusammenhänge in der richtigen Weise zum richtigen Zeitpunkt herzustellen, aber besonders viele waren es nicht, und ihre Methoden lassen sich nicht einfach reproduzieren, sodass wir ihren Erfolg zur Norm machen könnten. Klar ist dagegen, dass die Komplexität unserer zentralen Systeme weiter zunehmen wird, wir selbst aber nicht klüger werden.«10
Dass sich manche Vertreter der »moderaten Linken« zu Angriffen auf diesen populären Dokumentarfilm bemüßigt fühlten, zeugt an sich schon von einer düsteren Lage. Noch bezeichnender ist, wie unverblümt sie epistemologische und wissenssoziologische Grundannahmen der Neoliberalen übernehmen. Experten jeder Couleur warfen nach der Krise die Hände in die Luft und erklärten, die Wirtschaft sei einfach zu komplex, um sie zu verstehen – lieber betrachtete man die große Rezession als ein Naturereignis und ging wieder zur Tagesordnung über. Diese kulturelle Schwäche bestand schon vor der Krise, aber bei der Blockade von adäquaten Reaktionen auf das Debakel hat sie geradezu Wunder gewirkt. Wie in Kapitel 2 und 3 beschrieben und in Kapitel 6 genauer seziert, haben die Neoliberalen zum Problem von Wissen und Unwissen eine komplexe Position entwickelt. Nachvollziehen zu können, wie sie Unwissenheit als politisches Instrument einsetzen, hilft uns bei der Bewältigung der Tatsache, dass wir offenkundig für dumm verkauft wurden. Außerdem könnte sich dabei zeigen, dass es für die Linke an der Zeit ist, wieder selbst eine plausible Wissenssoziologie auszuarbeiten.
Der erste Schritt zu einer Wissenssoziologie und -geschichte der Krise besteht in der Erkenntnis, dass die Antworten auf sie auf unterschiedlichen Ebenen erfolgt sind, deren Botschaften sich in Inhalt und Zeitpunkt zwar nicht immer decken, aber schließlich so ineinandergreifen, dass sie jedwede nicht von den Banken und dem Finanzsektor kontrollierte politische Reaktion vereiteln. Die Steuerung dieser unterschiedlichen Ebenen erfordert Geschick. Es gibt zum einen die Ebene der allgemeinen Kultur, auf der die etablierten neoliberalen Bilder menschlicher Selbstentfaltung mit dem spürbar einsetzenden Zusammenbruch einer ganzen Lebensweise konfrontiert waren. Es gibt die Ebene öffentlich wirkender Wissenseliten wie der Mont Pèlerin Society, die kurzzeitig gelähmt waren und danach die Aufgabe hatten, das anhaltende akademische Geschwätz über die aus den Fugen geratene Welt aus dem Stegreif in eine neue Ordnung zu bringen. Es gibt (worauf ich in meiner Analyse großen Wert lege) ein allgemeines neoliberales Drehbuch für strategische Reaktionen auf schwere Krisen. Und schließlich gibt es die Wirtschaftswissenschaftler an den Universitäten. Sie waren zwar nicht der einzige Priesterorden, der sich im Besitz des ehrfurchtsvoll »die Ökonomie« genannten Schlüssels wähnte, aber ihr Wirken nach dem Einsetzen der Krise erwies sich als entscheidend, und zwar in einer meines Erachtens sowohl von Insidern wie der Öffentlichkeit kaum begriffenen Weise. Auch wenn sich die neoliberale und die neoklassische Tradition nicht aufeinander reduzieren lassen, verdankte sich das Wiedererstarken der Neoliberalen nach der Krise ganz wesentlich dem Zusammenspiel der Wirtschaftswissenschaft mit den Ebenen der Kultur und der Wissenseliten. Die neoklassische Wirtschaftslehre war in den anderthalb Jahrhunderten ihrer Geschichte nicht durchweg neoliberal orientiert; heute jedoch arbeiten beide Strömungen unübersehbar Hand in Hand. Deshalb widmen sich Kapitel 4 und 5 ausgiebig dem Wirken der Ökonomen nach 2007.
Wenn es um die Beziehung zwischen ökonomischem Wissen und Politik geht, zitieren Experten häufig ein Diktum von John Maynard Keynes aus seinem Hauptwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes: »Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen. Wahnsinnige in hoher Stellung, die Stimmen in der Luft hören, zapfen ihren wilden Irrsinn aus dem, was irgendein akademischer Schreiber ein paar Jahre vorher verfasste.«11 So elegant seine Prosa auch war, Keynes’ rudimentäre Wissenssoziologie hat sich als falsch erwiesen. Ökonomische Ideen haben nicht etwa, wie in einer gepflegten Séance aus der Zeit der Jahrhundertwende, durch ektoplasmische Schreiben der Verblichenen Eingang in die alltägliche Politik gefunden, sondern durch einen Prozess, der zugleich konkreter und komplexer ist, als die leicht tendenziöse Selbstschmeichelei des Ökonomen Keynes unterstellt.
Wirtschaftslehren erringen die Vorherrschaft, weil sie auf starken geistigen Trends in anderen Bereichen der Kultur und oftmals anderen Disziplinen aufbauen, und sie benötigen ihrerseits Förderer und Finanziers, um Ökonomen und schließlich die breitere Gesellschaft für sich zu gewinnen. Ideen mögen ein Handelsgut sein, aber sie werden nicht einfach vermarktet, auch wenn die Neoliberalen anderes behaupten. So wie die Geschichte sind auch die Ideen von Menschen gemacht, aber nicht in ungebrochener, direkter Weise. Ideen haben die gemeine Angewohnheit, sich auf ihrem Weg durch den Diskursraum zu verwandeln; manchmal schaden ihnen ihre Anhänger mehr als ihre Gegner. Außerdem scheinen Menschen mitunter von Natur aus unfähig zu begreifen, was man ihnen vorsetzt, und kreative Missverständnisse führen das Denken auf ausgetretene Pfade zurück. Im Getümmel dubioser Signifikanten ist die große Lüge König; doch das schließt nicht aus, dass das sie umgebende Stimmengewirr in den Dienst politischer Zwecke gestellt werden kann. Werden bestimmte Grundvorstellungen als neutral und selbstverständlich dargestellt, dann können sie umso besser als politische Bastionen dienen, um die Geschichte in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wenn sich bestimmte Lehrgebäude allen Widrigkeiten zum Trotz, etwa in einer Weltwirtschaftskrise, behaupten; wenn Wissen und Macht in einem Zustand der Erstarrung konvergieren, dann gibt es zweifellos etwas zu erklären.