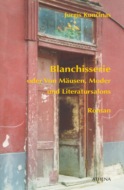Kitabı oxu: «Irgendwas, irgendwie, irgendwo»
Teodoras Četrauskas
Irgendwas, irgendwas, irgendwo
Ironische Stadtgeschichte
aus dem Litauischen von Klaus Berthel
ATHENA
Literatur aus Litauen
Band 3
Die litauische Originalausgabe erschien 1988 bei Vaga, Vilnius unter dem Titel »Kazžkas, kažkaip, kažkur. Ironiškos miesto istorijos«.
Die hier vorliegende deutschsprachige Ausgabe wurde ergänzt mit den bisher nicht in Buchform publizierten Geschichten »Homo nostro in der kapitalistischen Welt«, »Ist auch bei euch Frühling?«, »Unsere graue tschechische Handtasche«, »Besuch der behelmten Muse«, »Pressekonferenz« und »Gesetze werden unter Schmerzen entdeckt«.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
E-Book-Ausgabe 2013
Copyright © 1988-1999 by Teodoras Četrauskas
Copyright © der deutschen Ausgabe 2001 by ATHENA-Verlag,
Copyright © der E-Book-Ausgabe 2013 by ATHENA-Verlag,
Mellinghofer Straße 126, 46047 Oberhausen
www.athena-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (Print) 978-3-932740-86-2
ISBN (ePUB) 978-3-89896-839-3
Einleitung
Mir scheint, dass die deutsche Ausgabe der »Ironischen Stadtgeschichten«, die meisten davon entstanden in den achtziger Jahren, ein paar vorauseilende Bemerkungen erforderlich macht. Keineswegs deshalb, weil ich nicht an meine neuen Leser glaube und der Meinung bin, sie würden ohne Einleitung nichts verstehen. Sie verstehen auch so, aber mit Einleitung vielleicht besser. Hinzu kommt, dass die Menschen im Westen seit jeher allerlei Dinge über die Sowjetunion wissen wollten, auf die dieses kleine Buch nicht ohne weiteres Antworten parat hat, und wenn, dann allenfalls indirekt.
Beliebt sind Fragen wie die folgenden:
– Habt ihr Litauer auch zu Hause russisch gesprochen?
Die Antwort lautet: Nein. So vorbildliche Sowjetbürger waren wir nicht. Wären wir es gewesen, hätte sich die Unabhängigkeit vielleicht erübrigt, mitsamt allen Erörterungen, ob wir uns seinerzeit freiwillig unter Onkel Josephs Fittiche begaben oder ob ein gewisses Geheimprotokoll dies bewirkte. Ein so guter Bürger war, soviel ich weiß, nur Onkel Joseph selbst, der sprach zu Hause und auf der Arbeit nur russisch, obwohl er Georgier war.
Dann ist er gestorben, wurde demaskiert und aus einem offenen Grab, sprich Mausoleum, in ein geschlossenes verlegt. Und seine Idee, alle mögen russisch sprechen, blieb unverwirklicht, wie so viele erhabene Ideen in diesem Land. Daher bedienten wir uns zu Hause, auf der Arbeit und auf der Straße des Litauischen, wenn auch vorsichtig, Konkretes vermeidend.
Ständig hantierten wir mit jenem Irgendwas, Irgendwie und Irgendwo, um nicht grundlos aufzufallen.
– Aber ihr habt doch beinahe gehungert damals, oder? Wenn man einen Blick in eure Kaufhäuser ...
Gehungert? Wie hätten wir hungern können! Wir waren so etwas wie ein riesiger Offenstall der Union, führender Rind- und Schweinefleischlieferant für Moskau. In der Tat, in den Vitrinen hier waren dann häufig nur Rinderhufe zu sehen. Dafür hatte beinahe jeder einen guten Bekannten im Fleischkombinat, der die heiße Ware organisierte. Mein Nachbar Tolik etwa hat mich regelrecht erpresst, ihm wieder und wieder ein Stück Schweinelende abzukaufen. Die schmuggelten drei Frauen für ihn aus dem Kombinat, indem sie sich damit die Hüften polsterten. Jede von ihnen schaffte zwanzig Kilo, und zwar pro Tag.
– Und wie war das mit der schweren, bedrückenden Arbeit?
Was die Arbeit anbelangt, so war zu Sowjetzeiten ein Witz populär. Da kommen Japaner zu uns in eine Fabrik, es geht um die Einführung irgendeiner neuen Technologie. Nachdem sie sich kurz umgesehen haben, gehen sie wieder. Was denn los sei, werden sie gefragt. Antwort: Wir haben bemerkt, dass eure Werktätigen sich gerade in einem Bummelstreik befinden. Dabei haben die ganz normal Dienst geschoben ... Ich selbst kam gewöhnlich gegen elf in mein Verlagsbüro (Arbeitsbeginn war neun Uhr), begab mich dann erstmal in die Kantine, einen Kaffee zu trinken, und vielleicht noch einen Likör. Dann rauchte ich im Korridor und unterhielt mich über ein unverfängliches Thema. Hatte ich daraufhin eine halbe Stunde am Schreibtisch verbracht, war es Zeit, im Sportkomplex schwimmen zu gehen, Basketball zu spielen oder die Sauna aufzusuchen. Anschließend speiste ich im Restaurant, kehrte an meinen Arbeitsplatz zurück, hängte dort meinen Mantel auf und ging in die Kantine, einen Kaffee zu trinken, und vielleicht noch einen Likör. Dann rauchte ich im Korridor, während ich mich über ein unverfängliches Thema unterhielt, und nach einem weiteren Aufenthalt am Schreibtisch, es ging auf den Feierabend zu, bereitete ich mich auf das Nachhausegehen vor. Am Quartalsende war ich nicht selten Sieger im Sozialistischen Wettbewerb und wurde ausgezeichnet. Für 27 Rubel ging es dann in den Urlaub, nach Samarkant, Buchara oder sonstwohin, zur verdienten Erholung.
– Wenn es so war, warum habt ihr dann diese Idylle zerstört? Wo alles zum Leben Nötige zu organisieren war, Café und Sauna zum Daueraufenthalt wurden, und dafür obendrein noch Prämien und Auszeichnungen winkten?
Ja, warum eigentlich ... Vielleicht ist uns der Bummelstreik in Permanenz irgendwann langweilig geworden. Außerdem waren wir es müde zu klauen, was eigentlich ins Kaufhaus gehört, herzustellen, was niemand braucht, ständig mit jenem Irgendwas, Irgendwie, Irgendwo zu operieren oder Bücher herauszubringen, in denen auf fünfhundert Seiten eine negative Gestalt im Suff andeutungsweise die Wahrheit sagen durfte. (Ganz abgesehen von Büchern, in denen die Wahrheit überhaupt nicht vorkam.)
Vielleicht auch wollten wir uns einfach mal ausprobieren.
– Und wie ist es euch gelungen?
Je nachdem. Dem einen besser, dem anderen schlechter. Mein Nachbar Tolik beispielsweise hat Pech gehabt. Jene Damen, die für ihn die Schweinelenden schmuggelten, sind entlassen worden. Ohnehin sind die Supermärkte voll davon und Moskau kauft nicht mehr. Brüssel wiederum winkt ab, weshalb unsere Bauern Straßensperren errichten. Aber sonst geht es nur aufwärts. Unsere Basketballer haben voriges Jahr in Sydney beinahe das US-»Dream Team« nach Hause geschickt. Gott sei Dank nur beinahe. Eine olympische Niederlage dieser Dimension wäre für die Amerikaner schlimmer gewesen als die in Vietnam. Und wir wollen doch einen stabilen NATO-Partner. Alekna hat den Diskus weiter geschleudert als Riedel oder Schultz, auch unsere Radrennfahrerinnen sind seitdem in aller Munde. Aber das kostet euch Deutsche bestimmt nicht den Schlaf.
Ansonsten steht uns, was die Qualität des Biers angeht, weltweit der zweite Platz zu. Gut, dass es nicht der erste ist. Das wäre für euch dasselbe wie für die Amis, im Basketball ausgepunktet zu werden. Überhaupt geben wir uns zur Zeit kämpferisch. Unsere Militärs sind schon heute bereit, nordatlantische Bündnispflichten zu übernehmen. Wir warten aber, bis auch die Letten und Esten soweit sind. Schließlich wollen wir denen keine Komplexe bescheren.
Was mich persönlich betrifft, so ist vom Sport einzig ein Drei-Kilometer-Crosslauf geblieben, dazu zwanzig Minuten tägliche Schufterei am »Torsotiger«. Die ganze übrige Zeit verbringe ich am Schreibtisch, selbst die Samstage und Sonntage. Aber ich beschwere mich nicht, habe es selbst so gewollt. Man muss sich ausprobieren, wenn man schon vom Homo sovieticus zum Homo sapiens befördert wurde. So verlege ich das eine oder andere Büchlein bei ATHENA, ganz ohne Aufsehen und in kleinen Auflagen, um meine Freunde Günter Grass, Otfried Preussler und Edgar Hilsenrath nicht in Unruhe zu versetzen.
Irgendwas, irgendwie, irgendwo
Es gibt Wörter, die haben mehrere oder selbst ein Dutzend Bedeutungen. Und dennoch finden sich in unserer Sprache keine anderen Wortchampions, die praktisch eine unbegrenzte Zahl von Bedeutungen in sich aufnehmen und in jeden beliebigen Kontext passen wie die obengenannten.
I
Die Sonne ging früher auf an diesem Morgen und schien irgendwie anders. So auch der Wind: Suuuuuuubt, dann nichts, Suuuuuuuuubt, dann wieder Stille. Irgendwas erinnerte da an den Wellengang des Meeres. Die Bäume, von dieser seltsamen Sonne angestrahlt, sahen ebenfalls unalltäglich aus, nicht grün, eher goldfarben. Selbst die Sperlinge vergaßen ihre Herkunft und zirpten nicht, sondern trällerten nie Gehörtes – tschir viliiiiiii tschir viiiiiiiiii und so weiter. Die Katzen hingegen wirkten eher apathisch. Eine sibirische ließ sich sogar von einem Köter hinterm Ohr kraulen.
»Nein, nein und nochmals nein«, dachte Andrius, »an solch einem Tag, an dem die Sonne früher aufgeht und irgendwie anders scheint, der Wind so ungewöhnlich bläst, die Spatzen nie Gehörtes trällern, Hunde und Katze den Ausnahmezustand proben – da kann man irgendwie nicht mehr leben wie früher. Man darf es nicht! Man muss irgendwo hingehen und irgendwas tun.«
II
Das Buch eines bisher unbekannten Autors nimmt man stets irgendwie ergriffen zur Hand. Was wird es enthalten? Findet sich darin irgendwas, das zu sagen erlaubt, hier sei ein Schritt nach vorn getan worden? Oder ist man resigniert, weil man nichts findet, das irgendwie geistig bereichert, und man ärgerlich abwinkt: Ach, wieder so ein Unsinn. Die Unruhe verstärkt sich, nachdem man die erste Erzählung der Sammlung gelesen hat. In »Die Schönheit« etwa schildert der Autor irgendwie völlig neu die innere Welt eines sechzehn- bis achtzehnjährigen Mädchens. Die Heldin ist irgendwie naiv und beängstigend erwachsen zugleich. Der Held der Erzählung »Der Wüstling« wiederum, er ist irgendwo um die Fünfzig, erweist sich als ein Mensch, der zu spät begriffen hat, dass er ein Mann ist. Seine Gestalt steht irgendwie im Gegensatz zur »Schönheit«, ist gleichsam deren Antipode. Man könnte noch mehr Erzählungen dieses Bandes anführen, die irgendwie den Themenkreis unserer Literatur erweitern und ergänzen. Davon gibt es in der Sammlung nicht wenige. Aber es finden sich auch solche, die irgendwas Bekanntes, ja Abgedroschenes wiederholen. So ist die Hauptfigur der Erzählung »Ein unglücklicher Mensch« seit Jahren vergeblich hinter einem Regal her. Als ob der seine Bücher nicht irgendwo anders hinpacken könnte. Solche gleichsam »dingbesessenen« und daher nicht vollwertigen Mitglieder unserer Gesellschaft finden wir noch häufiger bei diesem Autor. Das ist kein Vorwurf, nur ein freundschaftlicher Hinweis, dass seine Dichtung noch nicht jene Grenze überschritten hat, wo man keine Fehler mehr macht. Abschließend wünsche ich ihm weitere schöpferische Erfolge, und sicher spreche ich im Namen der Mehrheit seiner Leser, wenn ich betone, dass diese Art Literatur gewissermaßen erwartet und irgendwie für Wert befunden wird.
III
Genossen, wir sind heute zusammengekommen, um die Ergebnisse des vergangenen Jahres auszuwerten und zugleich einiges in Bezug auf die fernere Tätigkeit unserer Einrichtung zu beschließen. Fassen wir die Resultate des vergangenen Jahres zusammen, dann muss gesagt werden, dass es Abteilungen gibt, die irgendwie effektiver arbeiten als andere, eine bessere Einstellung erkennen lassen, die Wichtigkeit ihrer Tätigkeit besser begreifen. Das führte zu gewissen Resultaten, diese Abteilungen sind irgendwie führend, überholen andere. Wir schätzen diese Mitarbeiter und bemühen uns, sie nach Kräften zu fördern. Sie alle werden, wie der Wandzeitung zu entnehmen ist, eingestuft, ihnen ist irgendeine Prämie sicher. Aber es gibt natürlich auch Abteilungen und Mitarbeiter, die nicht so effektiv arbeiten, nicht die erforderliche Einstellung besitzen, weniger die Wichtigkeit ihrer Tätigkeit begreifen. Das spiegelt sich in den Arbeitsresultaten wider. Diese Abteilungen sind also zurückgeblieben und nicht führend. Meiner Meinung nach muss alles dafür getan werden, dass jene zurückgebliebenen Abteilungen die vorangehenden irgendwie aufzuholen versuchen. Aber auch die Letztgenannten sollten nicht bei dem Erreichten stehen bleiben, nicht nachlassen. Dann wird in unserer Einrichtung eine Bewegung einsetzen, die uns irgendwie vorwärts bringt.
Ich beende hiermit meine Ausführungen. Wenn jemand etwas dazu zu sagen hat, möge er sich an den Versammlungsleiter wenden. Aber ich bitte darum, konkret und sachlich zu sprechen, damit sich ein irgendwie greifbarer Nutzen ergibt. Und nicht nur um des Redens willen geredet wird, was, wie ihr selbst versteht, pure Zeitverschwendung wäre.
Wie man aus fremden Sprachen übersetzt
(Einige praktische Ratschläge)
Übersetzt man aus fremden Sprachen, empfiehlt es sich, stets das Original zur Hand zu haben. Denn hat man das nicht, können sich bestimmte Abweichungen ergeben. Besonders nicht ganz richtige Übertragungen von gewissen Daten, Ortsangaben oder Personennamen. Die übersetzte Literatur wird davon natürlich weder besser noch schlechter, sind doch diese Dinge eher Hintergrund, Zugabe, Verzierung. Dennoch kann es deswegen große Unannehmlichkeiten geben. Gewiss findet sich so ein aufgeblasener Federfuchser und pedantischer Flohknacker, der schickt dann an die passende Stelle ein Briefchen, voll von galligen, von böser Ironie getränkten Bemerkungen. Es war mir neu, lesen wir da, dass der Name Fizgerald in die litauische Sprache als »Toni« transliteriert wird (obwohl »Toni« gewiss schöner klingt, sicher wäre auch der Autor selbst damit einverstanden). Oder: Der Übersetzer verlegt die Handlung aus irgendeinem Grund nach Europa, ins Erzgebirge, obwohl Fizgerald, dem Übersetzer zufolge »Toni« eigentlich »in the Rockies« jagt, also in den Rocky Mountains (als wäre nicht die Jagd selbst das Wichtigste, und deren meisterhaft übertragene Anspannung). Und schließlich: Wozu Daten des Autors, wenn sich der Übersetzer einen Teufel darum schert?
So ein Brief also wird das sein, obwohl Sie alles getan haben, was ein Buch zu einem Buch macht. Einen Esel wird der sie nennen, obwohl klar ist, wer der wirkliche Esel ist. Deshalb ist es eine der Bedingungen des Übersetzens, das Original in Griffweite liegen zu haben und hin und wieder einen Blick hineinzuwerfen.[1]
Eine gesonderte Betrachtung erfordern die sogenannten Klassiker. Das ist die Literatur, welche in diverse Lehrprogramme Eingang findet. Klassiker zu übersetzen ist deshalb so kompliziert, weil es nicht wenige gibt, die selbige im Original gelesen haben. Und schon meldet sich irgendein Gelehrter, einer von denen, die nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen, der wird dann auch Ihre Übersetzung in die Hand nehmen, und jeder hat dann seine Meinung. Ich hätte das so gemacht, hört man, ich habe mir das anders vorgestellt, man müsse dem Autor Ehre erweisen (mein Gott, als ob der Autor sein Onkel oder Cousin wäre). Alle diese Sachen nerven, halten sie auf, Sie gehen ihrer Inspiration verlustig und erleben ein Fiasko.
Ähnliches muss in Hinsicht auf die Übersetzung moderner Autoren gesagt werden. Denn das ist die Domäne sogenannter Snobs, und die sind noch schlimmer als die zuvor erwähnten Gelehrten. Diese Leute wissen wirklich nicht, was Erbarmen heißt. Sie können ihre vergötzten Meisterwerke in ihrer Muttersprache die ganze Tonleiter hoch- und wieder heruntersingen, sie in aller Großartigkeit neu erstehen lassen, dennoch wird das nichts weiter sein als eine »kraftlose Bemühung«, ein »blasses Abbild des Mondes im Wasser«, »ziemlicher Pfusch« usw.
Fazit: Ein nüchtern denkender Mensch, dem seine Gesundheit lieb ist, wird daher sowohl um Klassiker als auch um moderne Autoren von Rang einen Bogen machen. Er wird sich Bücher vornehmen, die gut in die Tasche passen, deren Verfasser in der Regel nicht mehr als zweihundert Wörter verwenden, darunter solche wie Bodyguard, Miss Philipina, Mercedes SL, Villa mit Swimmingpool, Colt usw. Leute, die solche Druckerzeugnisse vor dem Einschlafen lesen, werden Ihnen nur dankbar sein. Ein solides Honorar wird sich auf Ihrem Konto finden (Auflage! Was sind dagegen die von Klassikern und modernen Autoren). Sie werden satt und zufrieden leben – Grundstück, Žiguli, Palangra.[2]
Frohes Schaffen also.
Das objektiv beste Buch
Eine bedeutende Rolle im Prozess der Annäherung der Völker spielen Bücher, aber solche zu finden und auszuwählen, die diesen Prozess am meisten beschleunigen, ist nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick scheint.
Ich sitze mit Mohammed in einem Moskauer Hotelzimmer. Wir unterhalten uns. Ich bin ich, und Mohammed, das ist ein sich dem Pensionsalter nähernder, mittlerweile auffallend ergrauter und rundlich gewordener Freund aus sagen wir – Ossetien. Das Gespräch dreht sich um Frauen. Über Frauen kann Mohammed ohne Unterlass reden, in dieser Hinsicht ist er ein wahres Phänomen. Das Seminar hat erst gestern begonnen, und schon hat er es geschafft, sich vier – oder sechs – Frauen zu nähern. Einmal sagt er, es seien vier, ein andermal sechs, sei es, weil ihn die genaue Anzahl nicht interessiert oder weil er zwei Annäherungen für nicht so erfolgreich hält.
Diese Frage näher zu beleuchten, wage ich nicht – für mich ist es ein großes Problem, eine Frau anzusprechen, um so mehr eine, die mir gefällt. Deshalb habe ich gegenüber Mohammed einen Minderwertigkeitskomplex. Aber Schluss damit, wir sind schließlich nicht wegen solcher Sachen hierher gekommen. Deshalb schenke ich Mohammed und mir noch ein Gläschen (aus der Hotelbar) ein und sage – gar nicht zum Thema gehörend – Folgendes: »Hör mal, wir werden etwas dafür tun, dass sich unsere beiden Völker noch näher kommen.« Meine Worte erstaunten Mohammed nicht im Geringsten. Er nickte schweigend, weil wir beide, als Herausgeber von Büchern, dies unterstützen können. Natürlich, das ist unsere Pflicht. »Deshalb«, so rede ich weiter, »nennst du mir bis zum Ende des Seminars ein oder mehrere Bücher aus eurer Literatur, die diesem Anliegen am nächsten kommen. Ich werde es für unsere Literatur ebenso tun. Es soll das objektiv beste Buch sein. Wir treffen die Wahl hier in Moskau, denn wenn einer beim anderen zu Besuch ist, dann nehmen wir vielleicht nicht die richtigen Bücher, sondern die deiner Freunde oder der Freunde dieser Freunde. Trinken wir also auf die Objektivität, und am Ende des Seminars werden wir auf das Thema zurückkommen.«
Wir ließen die Gläser klingen, doch Mohammed, bevor er sein Glas hinunterstürzte, sagte: »Warum bis zum Ende des Seminars warten, ein solches Buch kenne ich bereits. Es ist das Buch meines Bruders.«
Ich sah ihn verdattert an, aber Mohammed sah mich ebenfalls an, ernst und unerschrocken. Vielleicht rührte der Eindruck auch daher, dass er von einer sehr männlichen Erscheinung war. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus, senkte den Blick und notierte mir den Buchtitel. Wieder fühlte ich mich minderwertig, doch andererseits, wer garantiert mir, dass das Buch seines Bruders nicht vielleicht doch das objektiv beste ist?
Danach sprachen wir über das gleiche Thema wie am Anfang, und vielleicht gehen wir noch irgendwohin tanzen.
Pulsuz fraqment bitdi.