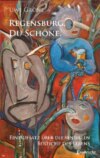Kitabı oxu: «Regensburg, Du Schöne»
Uwe Gröne
REGENSBURG, DU SCHÖNE
Ein Aufsatz über die sensiblen Bereiche des Lebens
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2017
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Regina E. Wittenbecher
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Einen großen Dank an meine Familie. Insbesondere meiner Schwester, meinem Schwager und meiner Nichte. Sie haben unermüdlich hinter mir gestanden.
Nicaragua, 02.02.2017
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Gedanken zu „Regensburg, die Schöne“
Regensburg, die Schöne (1): Einblick in einen Teilbereich eines Lebens
Regensburg, die Schöne (2): Schein und Realität
Berufsänderung
Konsum-Werbung
GEDANKENSPIELE
Gedanken zu „Regensburg, die Schöne“
Wenn nicht grade die Auswirkungen einer Wirtschaftskrise zu bewältigen sind, ist es bei unserer erlernten Sichtweise leicht, anzunehmen, dass die Art, wie wir leben, richtig ist. Die Gefahr ist dabei zu glauben, dass alles ‒ so wurde es uns im Vertrauen darauf schon von klein auf vermittelt ‒ normal und gut ist.
Aber was ist normal? Etwas, das schon immer so war? Das unsere Generation so kennengelernt hat und die davor ebenso? Der Kaufmann, Busfahrer, Nachbar, Freunde: Leute, die man gut kennt und die alle denken, es ist normal wie es ist. Und die, so orientiert, mit diesen Gegebenheiten leben? Immer abhängig von der jeweiligen Gesellschaftsform. Nicht bereit sie zu gestalten, sich von ihr voll Vertrauen gestalten zu lassen.
Ist es denn so normal, weil Du gar keine Unzufriedenheit spürst?
Es erscheint uns so, weil uns im jeweiligen Moment nichts anderes bekannt ist zum Vergleich und aus diesem Grund Unzufriedenheit gar nicht erst entstehen kann. Wir haben gelernt, ihr durch Ausgleichshandlungen zu begegnen. Diese Kompensation wird notwendig mit Beginn von Ungereimtheiten, die zu einer Unzufriedenheit führen könnten, entstanden durch einen Vergleich mit anderen Lebensformen.
Warum können die ‒ und nicht ich auch?
Wer hat uns diese Erkenntnisse vermittelt und wie weit sind sie auf dem Mist der Vermittler gewachsen?
Sie sind uns in einer Form gegeben und vermittelt worden, wie Gebrauchsanweisungen in Originalverpackungen. Positiv dargestellt für verschiedene Situationen unseres Lebens. Ähnlich wie in der Werbung.
Niemand hat uns ermahnt, kritisch zu sein. Speziell wenn es im beginnenden Erwachsenenalter um das Finden eigener, persönlicher Erkenntnisse, Werte und Normen in diesen Bereichen ging.
Also, wenn Du magst, frage Dich, was ist von dem, was Du machst normal in DEINEM Sinne. An was macht sich DEIN „normal“ fest? Gibt es DEINEN Sinn, oder reicht es Dir, Dich innerhalb der Norm zu bewegen? In der Gruppe zu bewegen? Nicht aufzufallen, „negativ“ aufzufallen? Und Dir so durch das Verhalten von Erwachsenen und durch Werbung bestätigen zu lassen, das alles „NORMAL“ erscheint?
Ist die Individualität eines Menschen, auch die Deiner Persönlichkeit, wie die der Anderen, sind die eigenen persönlichen Fähigkeiten, die in jedem schlummern, verkümmert oder konnten sie sich nicht entwickeln? Oder waren oder sind sie gar nicht vorhanden?
Oh doch, sie sind da! Es gibt nur in der Normalität in der wir leben, außer in Ausnahmen, in der Regel keinen Platz dafür, keinen Anreiz. Individualität und Fähigkeiten wurden nicht geweckt oder konnten beziehungsweise sollten sich nicht entwickeln.
In unserer Gesellschaftsform hat nur etwas Wert, das darauf hinführt zu erkennen, dass bei einem Bedürfnisnach Zufriedenheit meist nichts anderes bleibt, als sie sich zu kaufen.
Das Zauberwort. Auto, Wohnung, Kleidung, Hightech, Urlaub usw. Die gesamte Konsumwelt steht dafür offen und bietet gelenkte Möglichkeiten an, „Individualität“ zu erfüllen. Gelenkt durch Bedürfnisse, die künstlich geweckt werden.
Was dabei erlernt, gelernt wird ‒ nämlich die Schaffung von Kaufkraft! ‒ Ziel Numero eins des Lebens. Das geschieht in der Regel, wie bekannt, durch Arbeit. Ist der Wunsch nach Individualität groß, muss es viel von diesem Aufwand sein; ist er normal, geringer. Passend dazu werden im Internet als Lösungen Kredite ohne Schufa angeboten.
Eine weitere Erkenntnis neben der eben erwähnten, zeigt eine zweite gesellschaftlich erwünschte Ebene auf. Je mehr Energie für die Arbeit (=Kaufkraft) benötigt wird, umso weniger besteht die Bereitschaft zur eigenen Kreativität. Kreativität aber ist der Eingang zur EIGEN-Entfaltung. Sich dabei Gedanken zu machen, wie es zu schaffen ist, unsere unbewusste, etwas naive, eben erwähnte Betrachtungsweise unserer Welt abzulegen, um sie dann mit den bekannten Fragen „WIESO, WESHALB, WARUM?“ zu ergründen und danach zu versuchen, sie gemeinsam in unserem Sinne, neu zu gestalten und zu ändern.
Um nicht mehr länger als nötig, mehr und mehr zum Konsumenten geformt, gleichgeschaltet ‒ und angepasst zu werden.
Sich zugestehen, eigene Erkenntnisse von Zusammenhängen durch eigene Erlebnisse zu schaffen. Erkenntnisse, die ohne Geld zu erreichen und in ihrer Art den gekauften gegenüber so erhaben sind, dass sie außer Konkurrenz stehen. Sie unterliegen keiner Mode, keinem Trend, sind relativ frei wie die Gedanken und dazu, in diesem Zustand, nebenbei nicht zu stehlen.
Es gab in der Geschichte Zeitabschnitte, in denen radikale Gruppen meinten und immer wieder neu meinen, um Ziele eines politischen, wirtschaftspolitischen oder religiösen „Glaubens“ zu erreichen, erfordere es ein (normales) rückhaltloses Handeln. Wobei präparierte Gleichschaltung dabei schon immer den Boden bereitet hat.
Die Inkas ‒ das war zu ihrer Zeit völlig normal ‒ opferten ihren Göttern Menschen. In den Glaubenskriegen der katholischen Kirche gegen Andersgläubige wurden, nur ein Beispiel, im Kreuzzug gegen die Katharer in Beziers (Frankreich) 20 000 Menschen an einem Tag aufs Brutalste ermordet. Und das war für die Machthaber, Papst und König, normal. Massenmorde, wie sie auch im Faschismus und Stalinismus passierten, um noch ein paar weitere zu erwähnen, wurden zu ihrer Zeit als normal hingestellt. Sie spielten und spielen sich ständig dort ab, wo die tragenden Faktoren wirtschaftliche, machtpolitische oder religiöse Hintergründe haben und als Begründung dafür genutzt wurden und werden.
Und es war und ist immer das gleiche NORMAL, weil es ja schon immer so gehandhabt wurde. Weil es schon immer so war.
Eine Gruppe von Jesuitenmönchen verteidigte in Carcassonne (Südfrankreich) in einer Diskussion über Katharismus vor einigen Jahren die Ermordung der Mensch in Beziers mit „Nun ja es war nicht gut, aber in dieser Zeit normal und andere Gruppen haben es noch viel schlimmer betrieben.“
Es ist also nicht der Zeitraum der Handlung oder die Art, wie was gehandhabt wurde, wichtig, sondern die geschichtliche Stagnation oder Weiterentwicklung. Entwicklung der Verantwortung von Moral in Sozial- und Gesetzessituationen gegenüber der heute gesamten Umwelt von Machthabern in Staat und Gesellschaft.
In unserer Kultur ist die gesellschaftliche Verantwortung an die Politik abgetreten worden. Es sei viel einfacher, wurde vermittelt, und Bürger akzeptierten träge, kaum Motivation zu haben, Verantwortung zu übernehmen, Kraft und Spielraum zum Agieren im Leben zu bekommen.
Im Zeitalter der angeblichen „Aufgeklärtheit“ findet Verantwortung, vermittelt von Presse, Rundfunk und TV, im herkömmlichen Sinne fast nur noch bestätigend unter Gesichtspunkten des wirtschaftlichen Interesses statt. Bei dieser großen, permanenten sich stetig erneuernden Konditionierung der Gesellschaft ist das Ziel, dass nichts mehr dem wirklichen Zufall, wie beim Wetter, überlassen ist. Im Ablauf des täglichen Lebens ist alles andere auffällig, scheinbar nicht gewünscht, muss entspannt, glatt und schön sein.
Stellen sich einem Betrachter jedoch zwei oder mehrerer Kulturen, die eigene und eine andere ins Blickfeld, ist zu erkennen, wie unterschiedlich „normal“ sein kann.
Wartest Du mit Deiner Kultur in Drittweltländern am Busbahnhof einer Stadt, kannst Du einige junge Frauen sehen, die in dem Bahnhofsgewusel so gekleidet sind wie eben junge Frauen, die in der Stadt leben: chic und modern. Dann fährst Du mit ihnen am Ende des Tages zur Feierabendzeit zufällig mit dem gleichen Bus aufs Land und bist erstaunt, wenn sie an einer kleinen Hütte aus Brettern austeigen. Das ist ihr Zuhause, ihr erlerntes „Normal“, in das sie hineingewachsen sind. Fährst Du dann am kommenden Morgen wieder mit dem Bus in die Stadt zurück, kommt aus dieser kleinen Hütte ein Wesen, wieder chic, bei dem Du Dich kurz fragst: „Wie ist diese Person dahin gekommen? Sie passt nicht.“ Dann erkennst Du dieselbe Person wie gestern, aber anders gekleidet. Für sie ist es alle Tage ein Stück Theater, morgens und abends zwischen den Welten. Ihr „Normal“ und das der anderen, der großen „Normal-Welt“.
Ein anderes Beispiel: Ein alter Mann im gleichen Lebensbereich wird gefragt, welchen Beruf er hatte? Er antwortet, er sei jetzt 87 Jahre alt und er hätte Häuser gebaut und sei so etwas wie ein Baumeister gewesen. Als dann seine Bauwerke zu sehen sind, zeigt es sich, dass er von Hütten geredet hat, die er in seinem „NORMAL“-Verständnis als Häuser ansieht. Ein Haus kann abhängig von der jeweiligen Kultur auch eine Bretterhütte sein, wenn sie die Funktion des Hauses, des Wohnens bietet.
Das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Und aus dieser Komplexität heraus kommen wir zu jemandem in Regensburg, der versucht hat, sich eine interessante, einfache und für alle überschaubare Existenz zu schaffen.
Regensburg, die Schöne (1)
Einblick in einen Teilbereich eines Lebens
Visuelle Schönheit reicht nicht aus, wenn sich die oberflächliche Harmonie nicht mit dem, was sich darunter verbirgt, im Denken und Fühlen von Menschen in ihrem Lebensraum, im Einklang befindet. Im Folgenden bestimmt die Macht des Geldes und deren Besitzer mit, „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“-Gedanken und Ideen, die im Wege stehen, es zu vermehren.
Den Rahmen bildet die lokal festgelegte Ordnungsstruktur. Sie besteht, wird bei Bedarf geändert, neu erlassen und schleift sich danach fast von selbst ein. Der Rest fällt ‒ wo gehobelt wird, da fallen Späne ‒ unter den Tisch und wird weggefegt.
Amaro, ein alternativ wissender, lebenserfahrener, ein verantwortungsvoller Regensburger, arbeitslos schon seit längerer Zeit, wollte sich befreien von den Zwängen der Ämter und von Vorurteilen ihm gegenüber und hatte die Idee, sich auf eigene Weise selbstständig zu machen.
Er wollte das Gelände um das ehemalige Peterstor, in einen gleichbleibend sauberen Zustand versetzen: die Brache des ehemaligen Stadtgrabens, beginnend unterhalb der Brücke, die seit Jahren quasi als Mülldeponie von Passanten unachtsam genutzt wurde, und das anschließende Gelände oberhalb, am Besitz der Gräfin entlang, 100 Meter in Richtung Bahnhof und von der Brücke bis zur Skulptur am Kindergarten am Stadtgraben. Er harkte und sammelte Kippen, Verpackungen und Essensreste von McDonaldʼs, Plastiktüten und Cola-Becher, jeden Tag von früh bis zum späten Nachmittag.
Probleme mit den Stadtgärtnern gab es keine. Sie sahen ihn nicht als Konkurrenten. Es hatte sich bis zu ihnen herumgesprochen, dass er einen Teil ihrer Arbeit machte, ohne dafür Geld zu bekommen. Sie akzeptierten seine Arbeit.
Solange es von der Temperatur her möglich war, wohnte er unter dem Brückenbogen mit provisorischer Waschgelegenheit und lebte von Kleiderspenden und Essenspaketen, die ihm Touristen und Anwohner ausreichend als Anerkennung für seine Arbeit brachten.
Die „Brache“ verwandelte sich über Monate in einen einfallsreichen Garten mit vielen Blumen, Pflanzen und einem hüfthohen großen Herz aus gestapelten Backsteinen mit Sonnenblumen in der Mitte. Die Steine hatte er beim Aufräumen auf dem Gelände gesammelt.
Er wurde ein Anziehungspunkt.
Immer mehr Bürger begannen sich für seine Arbeit zu interessieren, Touristen machten extra in Gruppen oder einzeln einen Schlenker zu ihm, weil sie von ihm gehört hatten. Sie setzen sich eine Zeit nachdenklich auf die Brückenmauer, um zu sehen, was das für ein Mensch sei, der so etwas macht. Er war zu dieser Zeit der am meisten fotografierte Bewohner der Stadt.
Er bettelte nicht, schnorrte nicht, tat ordentlich gekleidet seine Arbeit, die er sich ausgesucht hatte und redete über seine Situation nur kurz und knapp, wenn er gefragt wurde.
Er fand so eigene Zufriedenheit und von den Menschen um ihn herum Anerkennung und Unterstützung.
In kleinen Mengen wurde ihm gegeben, was er brauchte. Für die Arbeit Werkzeug, Pflanzen, Blumensamen und für den Feierabend zum Schlafen eine Hängematte mit Schlafsack.
Wenn er gefragt wurde, warum er das alles mache, war seine Antwort, er wolle etwas Sinnvolles arbeiten, niemanden zur Last fallen und keine Abhängigkeiten.
Mit farbiger Tafelkreide schaffte er sich bis zum nächsten Regen ein visuelles Plenum. Er schrieb abends seine Gedanken über seine Arbeit, Ökologie und Natur auf den Gehweg oder an die Mauer der Brücke.
Um tagsüber ungestörter arbeiten zu können, bemalte er eine alte große Milchkanne mit Blumen und seinem Namen und hängte sie oben in eine Nische an die Mauer für die Post von Besuchern.
Eine angrenzende Gastwirtschaft kredenzte ihm täglich einen Milchkaffee.
Es wurde Herbst. Ein Bürger brachte ihm alte Bretter, um seinen Brückenbogen gegen Regen und Wind zu verschließen. Später dann, als es zu kalt wurde, brachte ein Zweiter unbenutzte Nut- und Federbretter, mit denen er die Brücke besser abdichten konnte gegen Wind und Kälte. Grüne Farbe verschönte das Ganze.
Es wurde Frühjahr.
Der Besitzer hatte sich schon vor einiger Zeit abgesichert gegen eine Haftung bei einem Unfall und mehrere Schilder anbringen lassen:
BETRETEN VERBOTEN
DER EIGENTÜMER
Am Besucherverhalten änderte sich nichts. Es kamen sogar noch mehr Menschen.
Da das Grundstück, als ehemaliger Stadtgraben, nur über eine Leiter betreten werden konnte, war es nur Amaro, der diesen Weg benutzte.
Es kann nicht sein, was …
Mit dem Frühling schien die Sache störend zu werden, sie sollte beendet werden.
Amaro bekam ein Einschreiben, in dem der Eigentümer auf Eigenbedarf hinwies und eine baldige Frist setzte. Bis dahin sollte für den Beginn des Baus eines Bürohochhauses geräumt werden. Andernfalls drohe Zwangsräumung.
Ein paar Plastikabflussrohre wurden symbolisch als Zeichen für den Baubeginn in den Graben getragen.
Ohne die Idee und Tat zu berücksichtigen, wurde nach landesüblichem Vorgehen, das Projekt „entfernt“. Der Versuch, es einzubeziehen in einen zeitlichen Ablauf, wurde nicht unternommen. Keine Anerkennung seiner Arbeit, weder von der Stadt noch vom Eigentümer.
Besitzstand rechtfertigt alle Mittel und bestimmt.
Eine Krähe hackt einer anderen kein Auge aus, und so wurde nicht der Franchise-Firma McDonaldʼs ein Einschreibebrief geschickt mit der Aufforderung, für ihren Müll in diesem Bereich aufzukommen, sondern Amaro, sich aus der Rechts- und Moralnische zu entfernen.
Amaro schaffte seine Habe zu einer Bekannten.
Aus dem Bürohaus wurde über Jahre nichts und der Graben erfüllt wieder seine ehemalige Funktion, ist wie zuvor Müllkippe der Passanten.
Aber es ist doch schön, dass diese Sache beendet wurde, so hatte alles wieder seine Ordnung ‒ nicht wahr?
Das, was Deutschland und andere Länder so liebenswert macht, ist die Menschlichkeit nach Verordnung.
Amaro hat Regensburg verlassen.
An dieser Stelle Dank an Amaro für seine Idee und seine Ausdauer und ein Danke dem, der ihm ein DENK MAL mit „Amaroland“ in „Google Maps“ geschaffen hat. Aber auch dieses wird entfernt werden. Denn was macht es für einen Eindruck, wenn auf dem Google-Kartenausschnitt der Baugrund mit diesem Namen erscheint?
Nur eindeutige Ordnung ist wirkliche Ordnung.
Info: www. Amaroland.de
Regensburg, die Schöne (2)
Schein und Realität
Eine Einführung zum Wieder-Einstieg in eine normale, schillernde, kapitalistisch geprägte Gesellschaft.
Jaulende Abrollgeräusche von den Reifen der großen Lkw auf der nahen Autobahn begannen die Wirklichkeit zu bestimmen. Erinnerungen wurden mehr und mehr zerrieben, zerbröselt.
Kurz gelang es ihm, wieder in Halbschlaf zu fallen.
Es war, wie hier, Morgen. Fischer saßen schweigend auf dem Strand, nahe dem Flutstreifen. Mit ihren Auslegerbooten warteten sie wie Skulpturen auf die auflaufende Tide, um ihre Boote ins Wasser zu schieben, über die vorgelagerten Sandbänke zu paddeln, raus zum Fischen.
Einer von ihnen stand auf, schob sein Kanu in die Wellen der ersten, jetzt mit Wasser gefüllten Mulde und begann, mit ruhigen Schlägen loszupaddeln. Nach und nach folgten ihm die anderen in schweigendem Selbstverständnis.
*
Vor sechs Jahren hatten sie sich in der Südsee kennengelernt. Etwas mehr als drei Jahre hatten sie danach in Südamerika gelebt. Waren dann hoffnungsfroh nach Spanien und weiter nach Deutschland gereist. Claris wollte eine Sprachschule besuchen, Jakob eine Zeit wieder als Pädagoge arbeiten.
Es war schwierig geworden, sich jetzt zurecht zu finden. Zu viel hatte sich in den mehr als 20 Jahren Abwesenheit in Deutschland verändert.
Über allem, was mit Arbeit zu tun hatte, schien ein Schild zu hängen: „Nicht stören!“
Niemand wollte auffallen.
Gestattete sich mal jemand, die Arbeit zu wechseln, wurde er, nun als „Berufseinsteiger“, gehaltsmäßig runtergestuft und entsprechend geringer bezahlt. Es war das Jahr 2008.
Ein Schachzug im Sinne des Arbeitgebers, da jeder, gleich welche beruflichen Vorerfahrungen er hatte, nun die niedrigste Gehaltsstufe bekam. Gleichzeitig wurde dadurch auch Unruhe am Arbeitsplatz durch Stellenwechsel vermieden. Eine ideale Situation zur Reglementierung am Arbeitsplatz.
Dazu kam die Hürde, dass ein Bewerber idealerweise dreißig Jahre alt sein sollte, zehn Jahre Berufserfahrung und Auslandserfahrungen vorweisen konnte und darüber hinaus motiviert, dynamisch und extrem belastbar sein sollte.
Und wie gesagt: keine Diskussion über das Einstiegsgehalt.
Dass sich die Gesamtsituation in allen Berufszweigen so entwickelt hatte, erkannten die beiden „Heimkehrer“, die noch nicht lange wieder im Land waren, noch nicht.
Die Wirtschafts- und Bankenkrise, von Südamerika aus in ihren Auswirkungen nicht realisiert, bewirkte Angst bei fast allen, arbeitslos zu werden, und stoppte Wünsche oder Ideen von Veränderungen schon vor Beginn der Überlegungen.
Als einzige Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, boten sich ihm Überführungsfahrten von Lkw von Südspanien nach Nordeuropa, oder seltener, zurück.
Eine hohe Präsenz von Zoll und Polizei war hier zu bemerken und von den anderen Verkehrsteilnehmern ein Jagen nahe der Null-Toleranz-Grenze.
Es war der neue Pulsschlag der justierten Leistungsgesellschaft.
Die Verkehrskontrollen erinnerten an die der DDR. Der Unterschied von früher zu heute war die Zweisprachigkeit. Das Vorgehen hatte fast etwas Beklemmendes an sich. Rationell-mechanisch und penibel. Nach deutscher Art, kühl-effizient. Fragen oder Kritik waren nicht erwünscht und wurden von den Beamten abgewürgt oder einfach übergangen.
Nach drei Monaten Arbeitssuche parallel zum Leben auf der Autobahn ergab sich für beide die Möglichkeit, in einem Jugendprojekt für deutsche sozial geschädigte Jugendliche, abseits gelegen im Gebirge in der Nähe von Malaga, zu arbeiten. Claris als Köchin, er als Pädagoge.
Es zeigte sich schnell, dass es eine spanische und eine deutsche Pädagogik-Fraktion gab.
Die daraus entstehende schwelende Unzufriedenheit aus Konkurrenz und gegenseitigem Unverständnis unter den Betreuern und das darauffolgende gegenseitige Ausspielen der Jugendlichen machte sich schnell breit. Es war nicht zu übersehen, dass es unter diesen Umständen sehr schwierig werden würde.
Eine Klettertour mit den Jugendlichen beendete diese Situation. Jakob stürzte ab und lebte nun drei Monate, davon zwei mit einem Bein im Gips, zu Hause. Claris blieb ebenfalls der Arbeit fern. Ein Aufenthalt für sie in der Gruppe ohne Jakob war zu brisant.
Jetzt konnte kam sein Widerstand gegen die Art von spanischer Pädagogik des Leiters gelegen, um die Situation schnell und günstig im spanischen Sinne zu bereinigen. Es fiel die Entscheidung, Claris und Jakob zu kündigen.
Eine interessante Arbeitsstelle in Deutschland nahe Regensburg bot sich im Internet an: ein Institut mit pädagogischen Projekten.
Das Bewerbungsgespräch verlief positiv, eine mündliche Zusage wurde bei einem Besuch vor Ort abgegeben, für die Zeit nach dem Gips am Bein.
Man verblieb mit: „Dann kannst Du kommen und anfangen, wenn der Gips ab ist. Ruf vorher an wann Du kommst.“
Als die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt war, gab es mehrere erfolglose Versuche, in Regensburg anzurufen. Trotzdem gaben die beiden die Wohnung in Spanien voller Vertrauen auf. Sie bauten auf die mündliche Zusage, fuhren los und erreichten Regensburg mit der Vorstellung, sobald wie möglich anzufangen zu arbeiten und zur Sprachschule zu gehen, die Claris machen wollte.
Es sei ja nur eine Frage von Tagen, wie die dann in Regensburg telefonisch erreichte Sekretärin mitteilte, bis die Ferien zu Ende seien und alle wieder anfangen würden zu arbeiten.
Es zog sich hin. Der Sachbearbeiter des zukünftigen neuen Arbeitgebers, mit dem die Absprache getroffen worden war, war ebenfalls im Urlaub und in den ersten zwei Wochen danach nicht zu erreichen. Dann hieß es, nach weiteren Anrufen, bei der Sekretärin, er sei nicht zu sprechen.
Ein ganzer Kerl mit Rückgrat. Er war eingeknickt vor seinem Chef.
Es blieb also als Erstes das Suchen einer Wohnung.
Regensburg, eine gefragte, sehr reizvolle Universitätsstadt, zu Semesterbeginn. Touristisch beliebt wegen seiner Altstadt mit den historischen Bauwerken aus der Zeit der Römer und dem Flair einer älteren, sehr schönen, interessanten Dame.
Dazu die Auszeichnung „UNESCO-Welterbe“ zu sein. Es schien hoffnungslos, etwas Bezahlbares zu finden.
Mit Hilfe von Jakobs Nichte fanden die beiden in einem Abrisshaus mit freundlicher Vermieterin, zeitlich begrenzt, eine Möglichkeit zu wohnen.
Der für Jakob völlig ungewohnte, aber notwendige Umgang mit dem Internet, erforderte von ihm große Bereitschaft, zu lernen, sich darin zu bewegen.
Der zweite Schritt war der Gang zum Arbeitsamt in der Galgenbergstraße. Hier wurde den beiden mitgeteilt, dass sie zur Arge, einer ihnen bis dahin unbekannten Institution im Gewerbepark gehen müssten, um Harz IV zu beantragen.
Es war ein wirklich eindrucksvolles Erlebnis, zum ersten Mal seit dreißig Jahren auf der Seite der Antragssteller zu stehen und darauf angewiesen zu sein, sich mit der knalligen Haltung einer Sachbearbeiterin, einer „Zahlentante“, zu arrangieren.
Wo es sich anbot, ließ sie ihren Unmut an Claris und Jakob aus. Immer darauf bedacht, mit ihrem Wissen (in Konkurrenz) zu zeigen, wer der Chef war, wurde den beiden klargemacht, dass sie bei Auslegungsentscheidungen im Zweifelsfall die negative Variante für die zwei Antragssteller wählen würde. Sie waren ihr wohl zu exotisch.
Kommt der alte Kerl nach fünfundzwanzig Jahren zurück nach Deutschland mit einer Frau aus Südamerika und beantragt finanzielle Hilfe! Eine Erstausstattung und Hartz IV. Eine Schande.
„Wir haben unsere Bestimmungen. Achtundfünfzig Quadratmeter? Das sind drei zu viel, das wird von uns nicht finanziert. Suchen sie weiter.“
Die Temperatur in der Wohnung des Abrisshauses sank im kommenden Monat ‒ es war Herbst ‒ so tief, dass Claris aus der Wolldecke nicht mehr rauskam. Die Handwerker hatten die Heizung abgeschaltet, um sie zu demontieren. Der kleine elektrische Heizkörper schaffte es unter Riesenkosten gerade so, die Wohnung überschlagen zu halten.
Der Auszug stand zwangsläufig unmittelbar bevor. Es sollte mit dem Abriss begonnen werden, doch die aufrechte Dame im Amt ließ sich nicht erweichen. „Es ist eben so, wir haben unsere Bestimmungen“, meinte sie.
Jakob war selten ein böserer Mensch begegnet und er hatte ihr bei einem Streit ins Gesicht gesagt, dass man vor 75 Jahren aus Personen wie ihr Führungskräfte gemacht hätte.
Das warʼs. Damit war die Amtsbrücke zwischen ihnen gesperrt und wenn überhaupt, nur noch mit besonderem Antrag zu benutzen.
Ein Wechsel zu einer anderen Sachbearbeiterin wurde auf Anfrage vom Amtsleiter abgelehnt. Also begegnete man sich ab sofort nur noch mit Handschuhen und Kneifzange.
Es blieb deshalb ganz konkret, um nicht von ihr ins angedrohte Not-Asyl mit Gemeinschaftsdusche im Keller und fünf anderen Parteien geschickt zu werden, nur der Gang an die Öffentlichkeit.
Aus fernen Tagen erinnerte sich Jakob an die Zeit in der Familienfürsorge eines Bezirksamtes in Berlin. Ein verzweifelter, aufmüpfiger Vater kam häufig und machte Rabatz um sein Recht zu bekommen.
Er war bekannt im Amt. Kam er am Pförtner vorbei, informierte der sofort das Jugendamt und die Familienfürsorge. Wenn er sich ungerecht behandelt fühlte in dem von der SPD regierten Bezirk, ging er ‒ den Tipp hatte er von uns ‒ zur gegnerischen Fraktion, der CDU, und bekam von den Personen dort, händereibend, seine Not gelindert.
Also bot sich hier das Gleiche an. Zumal Kommunalwahlen anstanden.
Das Vorgehen war nicht einfach. Jakob lehnte es eigentlich ab. Da es aber um Willkür ging, wählten die beiden den Weg.
In diesem Falle war die SPD die Rettung. Es war sehr beeindruckend, wie sich der Verordnete in ihrem Beisein, fassungslos über die Frage von drei Quadratmeter, für sie einsetzte.
Die Dame in der Arge verweigerte sich beim nächsten Besuch, mit der Begründung, er habe einen Weg genommen, den sie nicht akzeptieren könne, und verwies ihn an ihren Vorgesetzten.
Dieser war ein kluger Mann, der zu diesem Zeitpunkt über seinen Schreibtisch hinaussehen konnte. Er hörte sich die ganze Geschichte der mehr als fünfundzwanzig jährigen Vergangenheit außerhalb Deutschlands an, entschuldigte sich für seine Kollegin und unterzeichnete die Übernahme der Kosten für die Wohnung.
Später fiel seine Klugheit von ihm ab; er war wohl durch diese Entscheidung in so etwas wie Fraktionszwang gekommen. Unstimmigkeiten im Amt, so weit kommt es noch. Er tat später, wenn ihm Jakob und Claris auf dem Flur im Amt begegneten so, als würde er sie nicht kennen.
Ja, die Frau F. wie Friedrich hatte Einfluss.
Eigeninitiative als Alternative, war nicht gefragt bei der Arbeitssuche.
Es gab in der Presse Berichte über in der Familie misshandelte Kinder. Daher war es naheliegend, in diesem Bereich etwas zu tun. Das Problem war, dass der Bayerische Staat auf die Vorstellungen in Richtung eigenes Projekt mit äußerster Skepsis und wenig Beweglichkeit reagierte und nicht bereit war, etwas zuzulassen, was aus seiner Sicht zu unkontrolliertem Aus-der-Reihe-Tanzen führen konnte.
Etwas übertrieben gesagt waren jedes öffentliche Verhalten, nach Altersgruppe nicht NIKE oder Wolfskin zu tragen, nicht im ADAC zu sein und nicht bei IKEA in der Einkaufsrichtung einzukaufen, Auffälligkeiten, bei denen die Nase gerümpft wurde. In der Herde läuft sich’s eben besser, zufriedener und glücklicher. Jeden Tag kannst Du es sehen. Glücklich strahlendende Paare am Palmenstrand, eine Gruppe begeisterter Jugendlicher mit neuen Handys auf der Straße, oder zufrieden lächelnde Säuglinge mit Hipp in der Flasche. Alles störungsfrei im Rahmen der erwünschten Richtung.
Jedenfalls wurde die Idee, finanzielle Unterstützung im zuständigen Amt für ein eigenes Projekt zu erhalten, abgelehnt. Wo kommen wir da hin? Privat eine Pflegestelle einzurichten für misshandelte Kinder. „Wo denken Sie hin? Wir haben die Kirche. Sie hat eigene Einrichtungen. Sie schafft Arbeitsplätze, lässt sogar Gebäude errichten, oder vermietet eigene Häuser.“ (Mit der sozialen Feder am Hut kassiert sie die anfallenden Kosten mit Gewinn, letztlich aus Steuergeldern.) Sie ist aus Erfahrung fügsam, einfach zu kontrollieren und trägt oft die Kleidung derselben Fraktion.
Pulsuz fraqment bitdi.