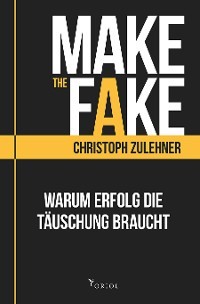Kitabı oxu: «Make the Fake.»

Für
CLEMENS
den Fußballtrainer mit der
totalen taktischen Unberechenbarkeit
und
LORENZ
den Modedesigner,
der Lederjacken zu Rockmusik
über den Laufsteg tanzen lässt

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-9818048-4-3
Denkbeschleunigung: Jörg Achim Zoll
Storytelling: Dorothee Köhler
Textartistik: Gerd König
Umschlaggestaltung & Satz: Gábor Vakulya
Gestaltungsidee: Komitee für gesunden Menschengeschmack
Illustrationen: MachDuPikto
Copyright © 2017 by Christoph Zulehner
Herstellung und Verlag:
ORIOL Verlag, eine Marke der Focus One Consult GmbH, Varel
E-Mail: info@oriol-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags oder des Autors.
www.christophzulehner.com www.oriol-verlag.de
| INHALT |
| 1 | ERST SCHEIN, DANN SEIN: Warum Faker keine Hochstapler sind |
| 2 | BERATER BERATEN BERATER: Eine Welt voller Experten |
| 3 | DIE GEBURT DES NIMBUS: Vertraut dir einer, vertrauen dir viele |
| 4 | SEHR ZU EMPFEHLEN: Was vorauseilt, ist der Ruf |
| 5 | MASKEN AUF! Die Unerlässlichkeit des Scheins |
| 6 | SPRECHSTUNDE: Weil Worte wirken |
| 7 | SIE SIND ENTLARVT: Verräterische Momente |
| 8 | DIE KUNST DER NACHAHMUNG: Alles Lernen ist Fake |
| 9 | DER FAKE ALS STRATEGIE: Überleben im System |
| 10 | ICH WEISS, DASS ICH NICHTS WEISS: Nichtwissen als Kompetenz |
| 11 | VERSPROCHEN IST VERSPROCHEN: Worauf der Markt vertraut |
| 12 | MAKE THE FAKE: Einladung zur Nachahmung |



ERST SCHEIN, DANN SEIN: WARUM FAKER KEINE HOCHSTAPLER SIND

Gert Postel gerät 1979 auf die schiefe Bahn. Die ersten 21 Jahre seines Lebens hat er rechtschaffen gelebt. Als Sohn eines Kfz-Mechanikers und einer Schneiderin ist er in einem Dorf bei Bremen aufgewachsen. Hat seinen Hauptschulabschluss und die mittlere Reife gemacht. Dann hat er eine Ausbildung als Zusteller absolviert und 1976 seine erste Arbeitsstelle als Postbote angetreten.
So weit, so unauffällig. Doch 1979 stirbt seine Mutter. Und Postel nimmt die erste von vielen falschen Identitäten an. Es ist der Beginn seiner Karriere als Hochstapler.
Mit einem gefälschten Abiturzeugnis bewirbt sich Postel beim Oberlandesgericht Bremen um einen Ausbildungsplatz als Rechtspfleger – und hat Erfolg. Immerhin vier Monate lang übt er ausgerechnet einen juristischen Beruf aus. Dann fliegt der Schwindel auf. Postel wird jedoch nicht zu einer Jugendstrafe verurteilt, sondern kommt glimpflich davon: Ihm wird lediglich auferlegt, an eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden.
Postel lernt nicht aus seiner Verfehlung – außer, wie er es beim nächsten Mal besser machen kann. Noch im selben Jahr zieht er aus seinem Elternhaus aus und mietet eine Wohnung in Bremen – unter Angabe eines falschen Namens und eines ebenso falschen akademischen Titels. Ein Jahr später ist er mit derselben Vorgehensweise erneut erfolgreich und erschleicht sich eine neue Wohnung, indem er einen gefälschten Ausweis der Zahnärztekammer vorlegt. Das Bremer Amtsgericht verurteilt ihn Ende 1980 zu einer Geldstrafe wegen unbefugter Führung eines akademischen Grades und Verwendung der geschützten Berufsbezeichnung „Arzt“.
Auch die erneute Verurteilung hält Gert Postel nicht davon ab, seine Hochstapler-Karriere weiter voranzutreiben. Ganz im Gegenteil – nun legt er richtig los: Er bereitet sich intensiv auf den nächsten Coup vor. An der Universität Bremen besucht er Vorlesungen in Psychologie und Soziologie, liest Fachbücher und lernt den Arztjargon. Mit diesen Qualifikationssurrogaten und einer gefälschten Approbationsurkunde bewirbt er sich erfolgreich um eine Stelle in einem Krankenhaus für Psychotherapie in der Nähe von Oldenburg, wo er drei Monate lang arbeitet. Unentdeckt. Zurück in Bremen arbeitet er als Notarzt in Vertretung und erlangt sogar eine leitende Position in einem Rehabilitationszentrum. Er fliegt erst auf, als eine Richterin ihn als denjenigen erkennt, der versucht hatte, eine Ausbildungsstelle als Rechtspfleger zu ergattern. In der Gerichtsverhandlung zeigt Postel sich jedoch so reumütig, dass er lediglich zu einer Geldbuße verurteilt wird. Mit einem blauen Auge davongekommen, ein weiteres Mal.
Tatsächlich ist Gert Postel alles andere als reumütig: Er macht weiter, immer weiter. Und immer weiter mit Erfolg. Er wird stellvertretender Amtsarzt in Flensburg, arbeitet in der Klinik von Dr. Julius Hackethal, als psychiatrischer Gutachter und für die Stuttgarter Landesversicherungsanstalt – natürlich immer unter anderen Namen und mit gefälschten Dokumenten. Zwischendurch erstattet er einmal Selbstanzeige. Ein anderes Mal fliegt er auf, weil er Unterlagen verloren hat, in denen sich gefälschte Ausweise befanden. Wieder wird er verurteilt, zu einer einjährigen Freiheitsstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wird.
Wie nur schafft er es immer wieder, sich solche hochrangigen Positionen zu erschwindeln? Die Fälle gehen doch durch die Medien! Immer mehr Menschen kennen seinen Namen! Heute können wir uns kaum noch vorstellen, wie so etwas über so lange Zeit funktionieren kann. Doch damals gab es noch kein Internet. Deutschland ist noch nicht in weiten Teilen digitalisiert und auch nicht so durchregistriert wie heute. Insbesondere nicht die Behörden. Und ein weiterer Umstand spielt Postel in die Karten: Er nutzt die deutsch-deutsche Wiedervereinigung und die damit einhergehenden bürokratischen Wirren aus, die so manches Schlupfloch offenließen.
1995 wird er in Sachsen Oberarzt im Maßregelvollzug eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie – unter seinem echten Namen! Es ist seine sechste Stelle als Psychiater. Im Juli 1997 fliegt er allerdings endgültig auf. Eine Kollegin erwähnt ihren Eltern gegenüber seinen Namen, und die erkennen ihn aus der Presse wieder. Postel tut an diesem Punkt etwas, das er mit vielen Hochstaplern gemeinsam hat: Er taucht erst einmal ab. Wir können davon ausgehen, dass er in dieser Zeit leidet. Denn so seltsam sich das anhören mag: Hochstapler haben eine ausgeprägte, nennen wir es: Berufsehre. 1999 wird er jedoch vom Landgericht in Leipzig zu einer Haftstrafe von vier Jahren wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung, Täuschung und Missbrauchs verurteilt.
Postel findet dennoch einen Weg, seinem Ego Genüge zu tun. Schon zwei Jahre später, nach seiner vorzeitigen Entlassung im Januar 2001, schreibt er einen Bestseller: „Doktorspiele – Geständnisse eines Hochstaplers“. Das Vorwort eines gewissen Dr. Gert von Berg hat Postel natürlich selbst verfasst.
Warum erzähle ich Ihnen die Geschichte von Gert Postel? Weil sie belegt, dass die Motive der Hochstapler ganz andere sind als die der Faker. Beweisführung folgt: Einen Hochstapler haben Sie gerade kennengelernt. Zeit, dass ich Ihnen einen Faker vorstelle.
Mich.
HERZ IN DER HOSE UND SCHLOTTERNDE KNIE

Meine Karriere begann ebenso einfach und unspektakulär wie die von Gerd Postel: Vor 35 Jahren, gleich nach meinem Schulabschluss, machte ich eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Damit haben sich die Gemeinsamkeiten zwischen mir und dem notorischen Hochstapler allerdings auch bereits erschöpft. Wenn wir mal von der Neigung zum medizinischen Sektor absehen. Meine Ausbildung begann mit einem Theorie-Block, der ein halbes Jahr dauerte. Danach hatten wir die ersten Patientenkontakte, und schon nach anderthalb Jahren mussten wir Krankenpflegeschüler auch Nachtdienste in der Klinik absolvieren. Und davor hatte ich einen Heidenrespekt. Um nicht zu sagen: Angst.
Heute wird viel gejammert über den Personalmangel in den Kliniken, aber ich kann Ihnen versichern: Damals war das noch schlimmer. Dass Krankenpflegeschüler allein Nachtdienste schieben mussten, gehörte zur Normalität. Auch in jener schicksalhaften Nacht, von der ich Ihnen erzählen will.
Auf der Nachbarstation gibt es in dieser Nacht zwar eine examinierte Pflegekraft, aber auf meiner Station bin ich bei meinem allerersten Nachtdienst allein – und zuständig für 35 Patienten. Eine der Patientinnen ist eine sehr nette, etwa 60-jährige Dame. Sie hat eine kleine Bagatelloperation hinter sich, nichts Ernstes. Ich sitze gerade im Aufenthaltsraum der Station und hoffe, es möge ruhig bleiben, als sie plötzlich nach mir läutet. Ich eile in ihr Zimmer, noch immer in der Hoffnung, es wird schon nichts weiter Dramatisches sein. Als ich eintrete, die Zimmertür ist noch nicht ins Schloss gefallen, schafft sie es gerade noch zu sagen: „Mir ist nicht gut, ich fühle mich so unwohl …“, da sackt sie auch schon in sich zusammen und bleibt ohnmächtig liegen.
Ein Beweis für die These: Angst zieht Unheil an. Genau davor hatte ich mich gefürchtet, und nun ist es passiert: Bei meinem ersten Dienst allein habe ich es gleich mit einer kollabierten Patientin zu tun. Mir rutscht das Herz in die Hose. Ich bin vollkommen unerfahren, ich habe gefühlt keine Ahnung von gar nichts. Dies ist mein erster Notfall. Adrenalin flutet meinen Körper. Zum Glück zeigt das intensive Training seine Wirkung, und ich beginne das Programm abzuspulen, das für diesen Fall vorgesehen ist: Ich renne in unseren Stationsstützpunkt, drücke den Notfallknopf und löse damit den Herzalarm aus. Dann schnappe ich mir das Reanimationsset und kehre so schnell wie möglich zu meiner Patientin zurück. Ich denke sogar daran, das Holzbrett unter meine Patientin zu schieben, das zum Reanimationsset gehört. Das ist wichtig, denn bei der Herzmassage darf die Unterlage nicht nachgeben. Ich kontrolliere noch einmal Herz und Kreislauf meiner Patientin und schaue nach, ob sie eventuell dritte Zähne im Mund hat – hat sie nicht. Gut, denn die wären hinderlich bei der Beatmung.
Auf geht’s, Christoph: Der Moment der Wahrheit ist gekommen.
Ich beginne mit der Herzmassage und der Beatmung. Ich weiß, ich muss auf diese Art und Weise den Kreislauf der Patientin aufrechter-halten, bis das Narkoseteam eintrifft, das Nachtdienst hat. Es liegt in meiner Verantwortung, dass die Patientin bis dahin überlebt.
In meiner Verantwortung. Ich bin Krankenpflegeschüler. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ich habe das noch nie gemacht. Ich muss sie retten. Ich habe keine Ahnung. Ich muss sie retten. Ich habe keine Ahnung. Ich muss …
… einfach nur alles so machen, wie ich es gelernt habe: 15-mal Herzdruckmassage, zweimal Atemspende – das war damals anders als heute –, immer im Wechsel. Schnell bin ich im Rhythmus, und mir kommt das Zeitgefühl abhanden. Hinterher kann ich nicht sagen, ob ich die Patientin nun zwei Minuten wiederbelebt habe oder eine halbe Stunde. Jedenfalls ist irgendwann das Notfallteam da – und kann meine Patientin retten. Sie lebt. Ich wanke aus dem Raum, kaum noch in der Lage, mich auf den Beinen zu halten, so sehr schlottern meine Knie. Erst jetzt, als die Anspannung nachlässt, begreife ich so richtig, was da eigentlich passiert ist. Natürlich haben wir diese Situation in der Theorie immer wieder durchgespielt und an Puppen geübt. Sie kennen das sicherlich aus einem Erste-Hilfe-Kurs. Was Sie dort gelernt haben, unterscheidet sich nicht von dem, was wir für einen solchen Fall beigebracht bekommen haben. Aber fühlen Sie sich fit für einen Notfall, nur weil Sie ein paar-mal auf einer Puppe rumgedrückt haben? Da habe ich eine Botschaft für Sie: Wenn es darauf ankommt, dann sind Sie es tatsächlich.
In jener Nacht hatte ich diese Situation zum ersten Mal wirklich erlebt. Und in mein ganzes Geschlottere mischte sich nach und nach die Erkenntnis: „Ich hab’s geschafft! Es ist das Schlimmste eingetreten, was ich mir vorstellen konnte. Doch ich konnte tun, was nötig und richtig war! Ich konnte helfen, einem Menschen das Leben zu retten!“
In dieser Nacht erkannte ich, dass ich meinen Aufgaben gewachsen war. Innerlich wuchs ich in diesem Moment bestimmt 30 Zentimeter. Und ein paar Tage später noch einmal so viel – als die Patientin von der Intensivstation auf meine Station zurückkehrte und sich überschwänglich bei mir bedankte.
Dafür, dass ich etwas getan hatte, wovon ich vorher nicht gewusst hatte, ob ich es tatsächlich drauf habe.
DER FAKE – DIE EINTRITTSKARTE INS ESTABLISHMENT

Wenn ich heute, 35 Jahre nach dieser Episode, den jungen Menschen anschaue, der ich damals war, dann sehe ich mich als einen wandelnden Beleg dafür, dass der Fake die Welt im Innersten zusammenhält. Ich glaube fest daran: Der Fake ist eine unerlässliche Kulturtechnik. Er ist es schon immer gewesen, und ist es heute noch mehr als früher: Lesen, Schreiben, Faken. Der Unterschied ist, dass wir über unseren Bildungsweg sprechen und über das Faken, die heimliche Kernkompetenz der Erfolgreichen, schweigen. Für alle, die in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt erfolgreich oder überhaupt produktiv sein wollen, ist der Fake die Eintrittskarte ins Establishment. In jeder professionellen Umgebung.
Angesichts einer immer weiter fortschreitenden Arbeitsteilung und Spezialisierung gewinnt der Faker das Vertrauen des Marktes, indem er zunächst vortäuscht, was er dann tatsächlich lernt und irgendwann beherrscht.
Der Fake ist also zweierlei – ein Versprechen an sich selbst und an den Markt: Ich kann, was ihr von mir erwartet, obwohl ich das noch nie bewiesen habe. Der Faker ist kein Hochstapler oder Betrüger, sondern versteht sich aufs Überleben im System. Gesellschaft und Markt verlangen den Fake, weil sie sich dann besser orientieren können. Fake ist keine negative Strategie der Kompetenzaneignung, sondern eine positive Strategie der Selbstbehauptung. Er ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Profi – erst Schein, dann Sein. Niemand faked zum Spaß, sondern weil es notwendig ist. Zu faken ist ein Zeichen, dass wir etwas wirklich können wollen. Dass wir sein wollen, was wir zu sein scheinen.
Bei Hochstaplern wie Gerd Postel verhält sich das genau umgekehrt: Sie wollen mehr scheinen als sein. Was sie antreibt, ist meist nicht so sehr die Gier nach Geld, sondern viel mehr die Gier nach Anerkennung und Bestätigung. Sie wollen Minderwertigkeitsgefühle kompensieren. Deren Ursache wiederum liege in „Entbehrungserlebnissen in der Kernfamilie“, so der Berliner Psychotherapeut Prof. Hans Stoffels in einem Interview mit dem NDR Fernsehen. Das Motiv des Hochstaplers ist also ein narzisstisches. Fliegt er auf, endet sein Spiel.
Der Faker spielt nicht. Der Faker hat ganz existenzielle Absichten.
Vom 17-jährigen Krankenpflegeschüler Christoph Zulehner kann ich das guten Gewissens behaupten. Was machte mich damals zum Faker? Das will ich Ihnen gern erklären. Ich mache das zunächst einmal an Äußerlichkeiten fest: Von Tag eins unserer praktischen Ausbildung an trugen wir weiße Kittel. Sie wissen ja, was Kleidung mit einem macht: Sie verleiht uns eine Aura. Trägt ein Mensch eine Richterrobe, verleiht das seinen Worten ein ganz anderes Gewicht, als wenn er in schlabberigen Jogginghosen und Plastiksandalen vor uns steht. Und genauso ist das mit der weißen Kleidung des Krankenhauspersonals: Wer einen weißen Kittel trägt, der wird schon eine Ahnung haben von dem, was er da tut – diese Erwartung haben die Patienten und ihre Angehörigen. Zumal sie ja nicht wissen können, ob derjenige vielleicht seinen ersten Tag in der Klinik hat oder eben den ersten Nachtdienst schiebt wie ich damals.
Und sind wir ehrlich: Wir wollen es gar nicht genauer wissen. Sie wollen von dem Arzt, der gleich in Sie hineinschneidet, nicht hören, dass das seine erste Operation am lebenden Patienten ist. Auch wenn es so ist. Wir wollen den Fake. Wir fordern ihn geradezu ein. Ohne den Fake würde kein Ausbildungssystem, ja die ganze Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Jeder Chirurg muss irgendwann seinen ersten Patienten operieren. Jede Krankenschwester zum ersten Mal Blut abnehmen. Jeder Friseur seinen ersten Haarschnitt machen. Jeder Steuerberater seine erste Steuererklärung, jeder Automechaniker seine erste Reparatur an den Bremsen. Jede Führungskraft muss nach der Beförderung ihre erste schwerwiegende Entscheidung treffen. Und jeder Selbstständige seinen ersten Kunden ganz eigenverantwortlich glücklich machen.
Und eben ich als Krankenpflegeschüler, beziehungsweise: designierter Lebensretter. Jeder von uns muss Dinge zum ersten Mal tun. Und dann zum zweiten und zum dritten Mal. Ohne die Erfahrung und Routine und Expertise, die von uns erwartet wird wegen etwas, das auf unserer Visitenkarte steht.
Der Fake ist eine Kulturtechnik, welche die Welt im Innersten zusammenhält.
Zu den Erwartungen von außen, die mich zum Faker machten, kamen noch die Anforderungen der Situation. Mir blieb ja gar nichts anderes übrig als die Rolle einzunehmen, die mir meine Maskierung aufzwang. Ich war Krankenpfleger, zwar ohne Ahnung und Erfahrung, aber Krankenpfleger, und in meiner Nachtschicht kollabierte eine Patientin. Also handelte ich.
Heute glaube ich zu wissen, worauf meine schlotternden Knie in jener Nacht zurückzuführen waren. Nämlich auf ein Phänomen, das ich damals noch nicht reflektieren konnte, heute jedoch als kennzeichnend für den ersten Fake beschreibe: Ich hatte in jener Nacht, nachdem das Notfallteam eingetroffen und ich nicht mehr für die Versorgung der Patientin zuständig war, so etwas wie eine Selbstbildkrise. Auf der einen Seite fühlte ich mich als ganz kleines Licht, das noch nichts konnte und eigentlich nichts hätte dürfen sollen. Auf der anderen Seite war ich in den Nachtdienst geschickt worden mit der Anforderung: In den nächsten zwölf Stunden bist du allein verantwortlich für 35 Patienten. Diese Bürde hatte ich umgehängt bekommen, und der musste ich entsprechen. Ich musste mich so verhalten, als könnte ich das – ich hatte keine andere Wahl. Mein Job – oder soll ich sagen: das Leben? – zwang mich also dazu, ein Faker zu sein. Oder die 35 Patienten ihrem Schicksal zu überlassen. Auch das ist ein Unterschied zum Hochstapler: Der riskiert ganz bewusst Menschenleben, wenn er sich trotz fehlender Qualifikation als Arzt ausgibt.
Am Ende der Nacht hatte sich herausgestellt, dass ich nicht nur Krankenpflegeschüler war, sondern eben auch Stationsbewacher und Lebensretter. Das ist das nächste Merkmal des Fakers: Das, was er vorgibt zu können, lernt er durch den Fake tatsächlich.
Aus heutiger Sicht ist das Faken für Anfänger. Ein unbewusster, auferlegter Fake. Es ist das, was viele Menschen jeden Tag machen. Machen müssen. Und sich vielleicht schlecht dabei fühlen – weil sie denken, sie seien eigentlich Hochstapler. Mehr Schein als Sein. Die Kunst liegt darin, den Fake ganz bewusst einzusetzen. Da wird der Sprung ins kalte Wasser zur bewusst erworbenen Kulturtechnik: wenn wir gezielt vom Schein zum Sein wachsen. Den Fake als Methode wählen, um etwas zu erreichen. Damit arbeiten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und ohne uns zu fürchten. Wenn wir faken und dabei locker bleiben. Dann nehmen wir die Täuschung in einem gewissen Maß und zeitlich begrenzt in Kauf, um das, was wir zu sein vorgeben, am Ende tatsächlich zu sein.
Ganz im Gegensatz zum Hochstapler, der bei seinem Tun ja kein höheres Ziel kennt. Sein Spiel endet, sobald er auffliegt. Fake it until you make it – wenn wir nach diesem Motto verfahren, verfolgen wir damit durchaus ein höheres Ziel. Wir wollen uns zu dem entwickeln, der wir sein können und zu sein anstreben. Absicht des Fakes ist es, als das angesehen und behandelt zu werden, was man irgendwann sein wird.
Und damit wird der Fake zu einer Notwendigkeit und Voraussetzung für den Erfolg.
DIE ANGST DES FAKERS

Wer ein Anfänger auf dem Gebiet des Fakens ist, der hat einen ständigen Begleiter – die Angst. Damals, vor meinem ersten Nachtdienst, machte ich mir fast in die Hosen vor Angst. Ich war zuständig für das Überleben von 35 Menschen! Das mag sich anhören, als ob ich dramatisiere, aber genauso fühlte sich das in dieser Situation an. Ich! Ein Krankenpflegeschüler!
Aber ich hatte nicht nur Angst, meine Patienten nicht gut versorgen zu können. In mir war auch eine große Angst, mein Versprechen, das ich mir selbst und den anderen gegeben hatte, nicht einhalten zu können – nämlich ein guter Krankenpfleger zu sein, dem man unbesorgt eine ganze Station zur Nachtwache anvertrauen konnte. Das ist der Schmerz des Fakers: die Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, die er an sich selbst stellt. Sein Versprechen – „Ich kann das, was ich hier tue!“ – nicht halten zu können. Diese Angst kennt der Hochstapler nicht. Der hat nur vor einem Angst: dem Moment des Auffliegens. Die Angst des Fakers dagegen ist Ausdruck seines Verantwortungsgefühls.
Ich bin mir sicher, jedem von Ihnen fällt eine Fake-Geschichte aus Ihrer Vergangenheit ein. Vielleicht beim Bewerbungsgespräch, als Sie gefragt wurden, ob Sie die Datenbanksoftware XY beherrschen. Als Sie Ihren ersten Kunden bedient haben. Als Sie zum ersten Mal ohne Fahrlehrer Auto gefahren sind … Wenn Ihnen eine solche Geschichte einfällt, dann denken Sie doch einmal darüber nach, was anschließend passiert ist – als Sie das nächste Mal in eine solche Situation kamen und wieder faken mussten. Da waren Sie schon deutlich entspannter, oder? Das war bei mir ganz genauso: Nicht lange nach dem Ende meiner Ausbildung als Krankenpfleger packte mich die Lust, das, was ich gelernt hatte, auch weiterzugeben. Ich fand das zwar sehr kühn, mich frisch diplomiert als Lehrer vor Schüler hinzustellen, die zum Teil älter waren als ich. Und ja, auch die Angst flammte wieder auf. Aber meine Entscheidung traf ich freiwillig, sehr bewusst und auch mit einer gewissen Lust. Denn ich hatte ein Ziel: Ich wollte vorwärtskommen. Mich weiterentwickeln. Nicht nur Krankenpfleger bleiben. Und ich hatte gelernt, dass das ohne den Fake ein Ding der Unmöglichkeit sein würde.
Also schlüpfte ich in die Rolle des Lehrers und agierte nach dem Motto: If you want to reach it, you´ve got to teach it. Die dafür vorgesehene Uniform – weiße Hose, weißes Hemd, weißer Mantel – gab mir das Gefühl, eine Ritterrüstung zu tragen, so sicher und geschützt fühlte ich mich darin. Mit dem weißen Mantel zog ich mein Selbstvertrauen an. Er war wie eine Maske für mich, hinter der ich mich leichter zu dem entwickeln konnte, der ich sein wollte. Mein damaliges Ziel – ein guter Lehrer an der Krankenpflegeschule zu werden – blieb hinter dieser Maske verborgen. Meine Botschaft an meine Schüler war nicht: Seht her, ich werde irgendwann einmal ein guter Lehrer sein. Sondern meine Botschaft lautete: Seht her, ich bin ein guter Lehrer. Ich habe das drauf, was ihr lernen wollt. Mein weißer Mantel ließ mich fast vergessen, wie leuchtend grün ich hinter den Ohren noch war.
WER KEIN EXPERTE IST, BEKOMMT KEINEN FUSS MEHR AUF DEN BODEN

Der Fake an sich ist keine neue Erfindung. Seit jeher geben Menschen vor etwas zu sein, wovon nicht sicher ist, ob sie es einlösen können. Die Inszenierung hat nicht Shakespeare erfunden, sondern ein Mensch, der in seiner Umgebung eine bestimmte Rolle einzunehmen hatte. Auch umgekehrt war es schon immer so: Menschen haben anderen Menschen aufgrund dieser Inszenierung Vertrauen geschenkt. Die Kulturtechnik Fake besteht aus dem Wechselspiel von Zutrauen und Vertrauen. „Der wird das schon richtig machen, immerhin ist er der Arzt!“ „Ihr vertrauen wir, sie ist die Staranwältin!“ „Auf ihn verlassen wir uns, er ist der Kapitän!“ „Sie ist die beste Projektmanagerin, die es für dieses Vorhaben gibt!“
Zu diesem Schein gehören übrigens nicht nur die entsprechende Kleidung und vielfältige Statussymbole, sondern auch ganz bestimmte Rituale. Wer beispielsweise in einer Arztpraxis lange im Wartezimmer gewartet hat, schließlich ins Arztzimmer gebeten wird und noch einmal warten muss, bis der Arzt dann endlich auch erscheint, der fühlt: Ich bin hier nicht der Maler, sondern die Leinwand. Gleich ist es so weit, der Herr Doktor kommt. Er schenkt mir seine wertvolle Zeit. Nur er kann mir helfen!
Zum Fake gehören immer beide Seiten: einer, der dank seiner Uniform und seines Auftretens den Anschein erweckt, als könne er das, was er tut. Und einer, der dem Gegenüber mit dem richtigen Auftreten, dem richtigen Habitus, den richtigen Ritualen zutraut, das gut zu können, wofür er ihn braucht, ihn engagiert, sich ihm anvertraut. Verantwortungsgefühl auf der einen Seite, Vertrauen auf der anderen: Das ist der gesellschaftliche Nährboden für den Fake.
Unsere Arbeitswelt spezialisiert und subspezialisiert sich immer stärker. In meinem Bereich, dem Gesundheitswesen, ist das ganz offensichtlich. Vor wenigen Jahren gab es noch Allgemeinchirurgen oder Allgemeininternisten. Heute gibt es nur noch Kniechirurgen, Handchirurgen, Wirbelsäulenchirurgen, Rheumatologen, Kardiologen oder Nephrologen. Und das ist auch kein Wunder: Unser Wissen verdoppelt sich alle vier bis fünf Jahre. Nicht nur das der Mediziner, sondern auch das aller anderen Fachrichtungen. Als arbeitender Mensch haben Sie genau zwei Möglichkeiten: Entweder Sie verdoppeln Ihr Fachwissen ebenfalls alle vier bis fünf Jahre – zeigen Sie mir den, der das schafft, und ich gebe Ihnen einen aus! – oder Sie spezialisieren sich.
Je mehr wir uns also in Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft entwickeln, die von Wissen lebt, umso mehr sind wir gezwungen, zu Spezialisten für unsere Fachgebiete zu werden. Und diese Spezialisierung mündet letztendlich in die Expertise.
Wer sich spezialisiert, kommt früher oder später zwangsläufig an den Punkt, an dem er die Fahne hochzieht, auf der steht: „Ich bin Experte!“ Diese Expertenbeflaggung ist nicht nur als Signal für Arbeitgeber oder Kunden wichtig. Sondern auch als Signal an Kooperationspartner. Denn Spezialisierung geht automatisch mit Kooperation einher. Je allgemeiner ich tätig bin, je mehr Fähigkeiten ich selbst bis zu einem gewissen Grad abdecken kann, weil mein Business nicht so sehr in die Tiefe geht, desto weniger muss ich mit anderen kooperieren. Je spezialisierter ich allerdings arbeite, desto mehr muss ich kooperieren, mich mit anderen koordinieren – und akzeptieren, dass ich mich in Ko-Kompetenz mit anderen befinde.
Das heißt wiederum: Ich muss mich aus der Deckung trauen. Ich muss die Fahne hochziehen und mich als Experte oder Spezialist für dieses oder jenes Fachgebiet sichtbar machen. Und ich muss Kulturtechniken entwickeln, um mich als Spezialist oder Experte zu präsentieren und in diesem Feld zu bewegen – damit andere auf mich aufmerksam werden und auch wissen, wofür ich Experte bin. Selbstvermarktung ist die Devise. Und sobald ich das tue, beginnt der Fake.
Der Fake ist so etwas wie die Vertriebstechnik des Experten. Er dient dazu, die im Entstehen befindliche Expertise an einer Person zu „befestigen“. Wer sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten will, der kann gar nicht anders, als zu einem gewissen Zeitpunkt ein Faker zu werden. Der eine früher, der andere später. Es gibt keine Alternative zum Fake. Jedenfalls ist mir keine bekannt. Der Fake macht Karrieren. Er ist keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung des Erfolgs. Er ersetzt nicht die Qualifikation – das wäre Hochstapelei. Doch er schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Qualifikation überhaupt zum Tragen kommt. Das gilt übrigens branchenunabhängig. Ganz egal, wo Sie hinschauen, ob in der IT, in der Medizin, bei Steuerberatern oder auch den Rechtsanwälten: All diese Berufsbezeichnungen gibt es in ihrer ursprünglichen Form kaum noch. Dafür gibt es heute: Verkehrsrechtsexperten, Strafrechtsexperten, Scheidungsexperten und Zivilrechtsexperten. Nicht anders in den nichtakademischen Berufen: KFZ-Mechaniker? Das ist so letztes Jahrtausend! Heute gibt es Automobil-Mechatroniker für Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik, System- und Hochvolttechnik oder Karosserietechnik.
Ganz gleich, in welcher Branche Sie sich umschauen: Experten, soweit das Auge reicht.